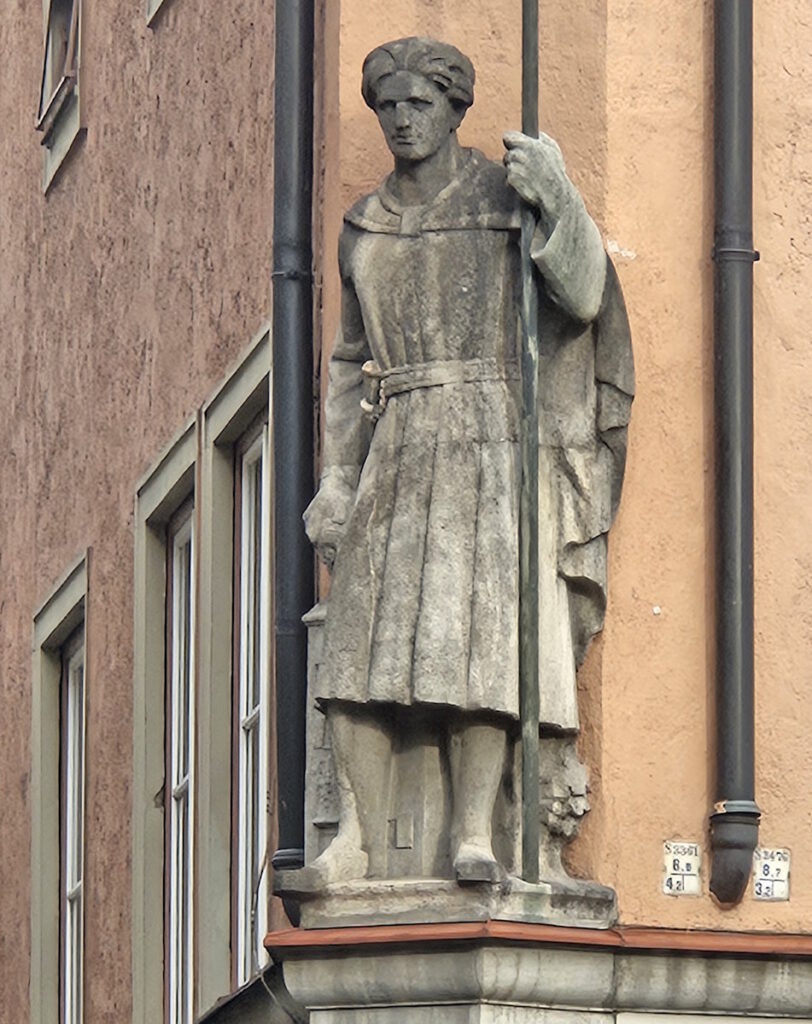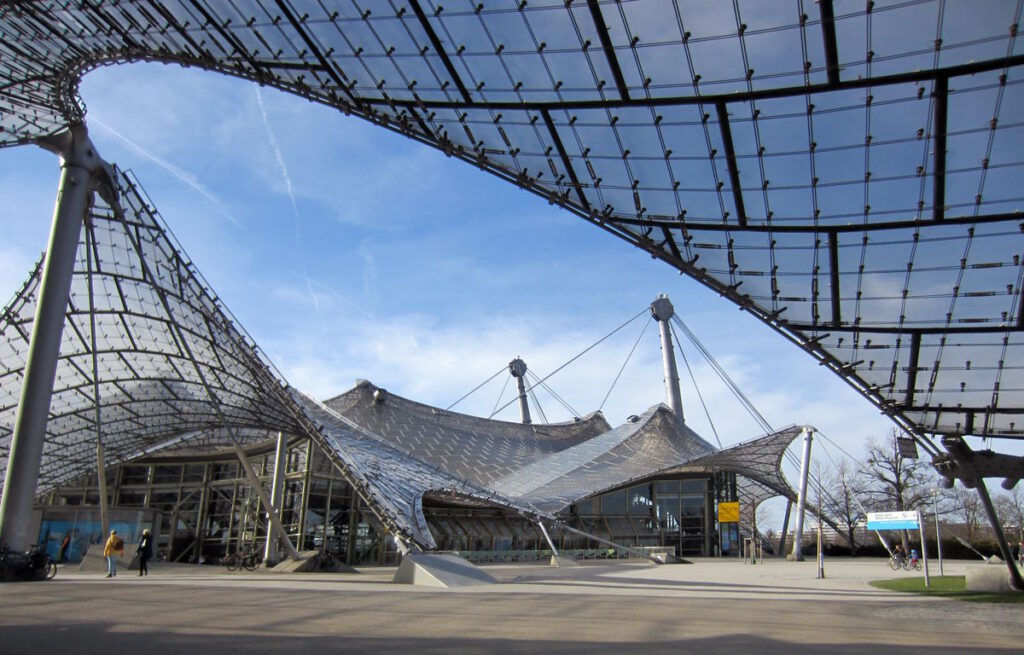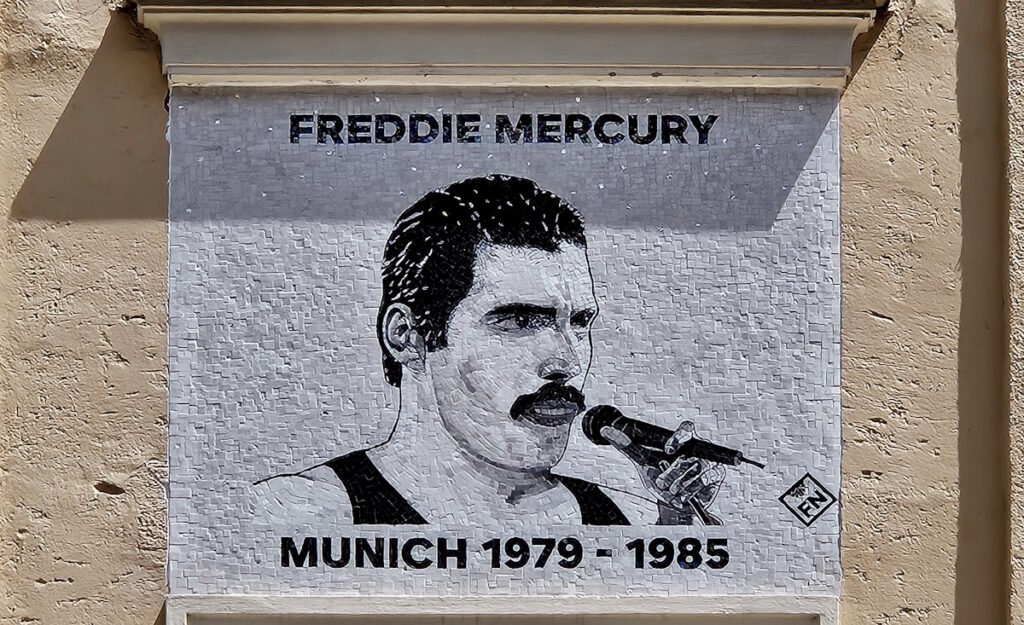München: Stadtgeschichte
München Stadtgeschichte 1158
Heinrich der Löwe: Stadtgründung im Mittelalter
Am Marienhof in München wurden Siedlungsspuren aus der Zeit vor der ersten Jahrtausendwende gefunden, und auch auf dem Petersbergl oder nordwestlich davon könnten damals Mönche aus dem Kloster Schäftlarn gelebt haben. Aber die offizielle Gründung Münchens erfolgte erst 1158.
Der 1156 von Kaiser Friedrich I. Barbarossa mit dem Herzogtum Bayern belehnte Sachsenherzog Heinrich der Löwe aus der Welfen-Dynastie ließ 1157/58 ungefähr bei der heutigen → Ludwigsbrücke (»am gachen Steig«, Gasteig) eine Holzbrücke über die Isar bauen, gleichzeitig die Isar-Brücke bei Feringa (heute: Oberföhring) niederbrennen und vereitelte den Versuch, sie wieder aufzubauen. So heißt es zumindest; gesichert ist die Zerstörung der Föhringer Brücke nicht, und beim neuen Isar-Übergang könnte es sich zunächst auch nur um eine Furt gehandelt haben. Jedenfalls büßte der Bischof von Freising den Brückenzoll ein, den vor allem Salzhändler bei der Überquerung der Isar von Ost nach West zu entrichten hatten.
Bischof Otto von Freising war zwar ein Onkel des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa, aber der wollte es sich mit dem mächtigen Welfenherzog Heinrich dem Löwen – einem seiner Cousins – nicht verderben. Deshalb vermittelte er 1158 auf dem Pfingsthoftag in Augsburg eine Einigung der Kontrahenten, sprach der Siedlung im Westen der neuen Isar-Überquerung Markt-, Münz- und Zollrechte zu und sorgte dafür, dass das Bistum Freising mit einem Drittel an den Einnahmen beteiligt wurde.

Im Augsburger Vergleich vom 14. Juni 1158 taucht erstmals die Bezeichnung »apud Munichen« auf, die »bei den Mönchen« bedeuten könnte. Deshalb gilt 1158 als Gründungsjahr von München, einer Gemeinde, deren Stadtrechte ab 1214 urkundlich nachweisbar sind.
Das Münchner Stadtwappen zeigte ursprünglich einen Mönch. Das bezog sich auf die Mönche, die schon vor der Gründung Münchens auf dem Petersbergl oder unweit davon gelebt haben sollen. Im Lauf der Jahrhunderte wurde der Mönch kindlicher dargestellt – und so zum »Münchner Kindl«, zuerst zu einem Buben, inzwischen einem Mädchen. (Die Stadtfarben Gold und Schwarz entstanden wahrscheinlich unter Kaiser Ludwig IV. und gehen auf das Wappen des Heiligen Römischen Reiches zurück: einen schwarzen Adler im goldenen Feld.)


München Stadtgeschichte 1180 ‒ 1294
Herzog Otto I. etabliert die Herrschaft der Wittelsbacher in Bayern
Gegen Ende der Siebzigerjahre fiel Heinrich der Löwe – der wohl nie in München war – bei Kaiser Friedrich Barbarossa in Ungnade. Der Staufer entzog dem Welfen 1180 sowohl die Reichslehen als auch die 1158 für München gewährten Rechte und belehnte den Wittelsbacher Pfalzgrafen Otto I. mit dem Herzogtum Bayern (Regensburger Schied). Damit begann die Herrschaft der Wittelsbacher in Bayern, die bis 1918 dauerte: 738 Jahre. Die Zoll- und Marktrechte (nicht aber das Münzrecht) für München übernahm der Bischof von Freising.
Georg Wrba schuf 1906 das Reiterstandbild Herzog Ottos I. auf der Wittelsbacher Brücke,
und Ferdinand von Miller d. J. gestaltete 1911 ein weiteres, das vor der Bayerischen Staatskanzlei zu finden ist.
Herzog Otto I. starb bereits drei Jahre später (1183). Seine Witwe Agnes von Loon und zwei ihrer Schwäger übernahmen die Vormundschaft für den 1173 in Kelheim geborenen Sohn Ludwig, bis dieser 1192 die Schwertleite erhielt.
1204 gründete Herzog Ludwig I. Landshut und verlegte die Wittelsbacher Residenz von Regensburg dorthin.
Der Staufer-Kaiser Friedrich II. belehnte Ludwig den Kelheimer 1214 mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein. Damit begann die Doppelherrschaft der Wittelsbacher in Bayern und der Pfalz. So kam der Pfälzer Löwe, das Wappentier der Pfalzgrafen bei Rhein, ins bayrische Staatswappen. Das weiß-blaue Rautenwappen erbten die Wittelsbacher 1247 von den Grafen von Bogen.
Herzog Ludwig I. wurde 1231 in Kelheim erstochen. Zeugen der Tat lynchten den Mörder, dessen Motive nicht aufgeklärt werden konnten.
Vermutlich zog sich der Bischof von Freising schrittweise aus München zurück. Allerdings blieb die einzige Isarbrücke weit und breit in seinem Besitz, und München musste deshalb jedes Jahr einen Teil des eingenommenen Brückenzolls abgeben, zunächst an den Bischof, dann an das Hochstift Freising und schließlich an den bayrischen Staat als Rechtsnachfolger des 1802 säkularisierten Hochstifts.
1255, zwei Jahre nach dem Tod des Herzogs Otto II., kam es zur ersten bayrischen Landesteilung: der Sohn Ludwig II. erbte neben der Pfalzgrafschaft das Herzogtum Oberbayern, und sein jüngerer Bruder Heinrich XIII. bekam das Herzogtum Niederbayern. Während Heinrich in Landshut residierte, richtete Ludwig der Strenge eine bereits im 12. Jahrhundert existierende Burg (heute: → Alter Hof) als erste Residenz der Wittelsbacher in München ein.


1271 gab es in München bereits drei Pfarrkirchen: Eine gotische Basilika ersetzte Ende des 13. Jahrhunderts die ursprüngliche romanische Kirche St. Peter auf dem Petersbergl in München. Eine im 13. Jahrhundert von den Wittelsbachern errichtete spätromanische dreischiffige Basilika wurde 1271 zur zweiten Pfarrkirche von München (Frauenkirche). Die romanische Katharinenkapelle des 1208 von Herzog Ludwig dem Kelheimer außerhalb des Talburgtors gestifteten Spitals wurde 1250 in einem Schutzbrief des Papstes als »ecclesia sancti spiritus de Monacho« bezeichnet (Heilig-Geist-Kirche von München) und 1271 zur dritten Pfarrkirche der Stadt. (Nachdem Spital und Kirche 1327 durch einen Stadtbrand zerstört worden waren, entstand bis 1392 ein gotischer Neubau.)
Alben über den Alten Peter, die Frauenkirche und die Heilig-Geist-Kirche in München
Noch im 12. Jahrhundert war eine Stadtmauer gebaut worden. Deren Eckpunkte waren: im Osten das Talburg- oder Untere Tor (später ins Alte Rathaus integriert), im Süden das Innere Sendlinger Tor beim heutigen Ruffini-Haus (Pütrichturm, Blau-Enten-Turm, Ruffiniturm; 1808 abgerissen), im Westen das Obere Tor in der heutigen Kaufingerstraße (Kaufinger Tor, Schöner Turm; 1807 abgerissen) und am Nordrand des heutigen Marienhofs zwei Innere Schwabinger Tore: der Wilbrechtsturm (1691 abgerissen) und der Krümleins-Turm (1842 abgerissen). Das Bevölkerungswachstum zwang Herzog Ludwig II. allerdings dazu, das Stadtgebiet zu erweitern und 1285 mit dem Bau eines neuen Mauerrings zu beginnen.
Im Lauf der Zeit entwickelte sich in München eine autonome bürgerliche Stadtgemeinde mit eigenen Verwaltungsorganen. Herzog Rudolf I., der Sohn und Erbe Ludwigs des Strengen, bestätigte 1294 ‒ gleich im ersten Jahr seiner Amtszeit ‒ Münchens Stadtrechte, die niedrige Gerichtsbarkeit und die Selbstverwaltung durch einen Stadtrat, dem zwölf Geschworene angehörten. Spätestens 1328 kam zu diesem Inneren Rat ein Äußerer hinzu, dem 24 Patrizier angehörten. Im »Rudolfinum« wurden erstmals auch Zünfte erwähnt. Diese vertraten nicht nur ihre Berufsinteressen, sondern strebten auch eine Beteiligung am Stadtregiment an. Außerdem spielten sie eine entscheidende Rolle bei der Stadtverteidigung und hatten deshalb für eine entsprechende Bewaffnung zu sorgen.
Am Ende des 13. Jahrhunderts übertraf Münchens Wirtschaftskraft die aller anderen bayrischen Städte.
München Stadtgeschichte 1302 ‒ 1347
Ludwig der Bayer: Mittelalterliche Kaiserresidenz in München
Ab 1302 regierten Rudolf I. und sein jüngerer Bruder Ludwig von Wittelsbach gemeinsam in Oberbayern. Aber als 1314, im Jahr nach dem Tod des römisch-deutschen Kaisers Heinrich VII., einige Kurfürsten den Habsburger Friedrich den Schönen zum König wählten und andere den Wittelsbacher Ludwig, hielt Herzog Rudolf I. nicht zu seinem Bruder, sondern zu den Habsburgern. Der Streit dauerte an, und Ludwig geriet darüber hinaus in einen Konflikt mit dem Papst, der ihn 1324 exkommunizierte.
Nach einer Reihe von Niederlagen zog Rudolf sich aus München zurück und überließ seinem Bruder Ludwig 1317 sowohl die Herrschaft in Bayern als auch in der Rheinpfalz. Zwei Jahre später starb er in Wolfratshausen.
1322 besiegte König Ludwig seinen Kontrahenten Friedrich von Habsburg in der Schlacht bei Mühldorf bzw. Ampfing. Es soll die letzte große Ritterschlacht ohne Feuerwaffen gewesen sein. Weil Münchner Bäckerknechte Ludwig in der Schlacht das Leben gerettet hatten, schenkte er der Bäckerbruderschaft ein → Haus im späteren Graggenauer Viertel. So heißt es, aber die Vorgänge gehören wohl zumindest teilweise in den Bereich der Legenden.
Fresko in den Hofgartenarkaden: Ludwig der Bayer besiegt 1322 Friedrich den Schönen
Erinnerung an das Bäckerbruderschaftshaus, Tal 15
Vorsorglich ließ König Ludwig die Reichsinsignien nach München bringen. Ludwigs Romzug konnte der Papst von Avignon aus nicht verhindern. In Mailand setzten italienische Bischöfe dem Wittelsbacher 1327 die eiserne Lombardenkrone auf; im Januar 1328 jubelte das Volk Ludwig IV. in Rom zu, und der »Volkskapitän« Sciarra Colonna sorgte dafür, dass drei Bischöfe und vier »Syndici« des römischen Volks den Wittelsbacher gegen den Willen der Kurie zum Kaiser krönten. Selbstverständlich akzeptierte der Papst das nicht; bei ihm war Ludwig nicht Kaiser, sondern einfach nur »Der Bayer«.

Im Jahr darauf (1329) trat Kaiser Ludwig der Bayer in Pavia seinen Neffen Rudolf und Ruprecht die Rheinpfalz und den bayrischen Nordgau (Oberpfalz) ab.
In einer Goldbulle bestätigte Kaiser Ludwig der Bayer der Stadt München 1332 das Salzmonopol im südostdeutschen Raum: Die Salzsender mussten ihre Ware auf dem Weg nach Westen und über die Isar zwischen den Alpen und Landshut zwingend nach München bringen, dort abladen und zum Verkauf anbieten (Stapelrecht). Zur Lagerung vor dem Weitertransport wurden um 1400 drei Salzstadel am heutigen → Promenadeplatz im Kreuzviertel gebaut. Ein vierter Salzstadel entstand 1487. Die Zölle und Markteinnahmen trugen entscheidend zum Aufstieg Münchens bei. Salz wurde nicht nur zum Würzen gebraucht, sondern auch als Konservierungsmittel, also zum Pökeln und Räuchern oder um Rüben- oder Sauerkraut zu machen.
Der zweite Mauerring, mit dessen Bau 1285 begonnen worden war, wurde 1337 mit dem → Isartor fertiggestellt. Die Stadtmauer mit dem Isartor, dem → Sendlinger, Neuhauser und Schwabinger Tor schützte nun ein Gebiet, das fünfmal größer war als zuvor. (Das damalige Neuhauser Tor kennen wir heute als → Karlstor, und wo heute der → Odeonsplatz ist, befand sich das 1817 abgerissene Schwabinger Tor.)

Unter Ludwig IV. war der → Alte Hof in München die erste feste Kaiserresidenz in Deutschland. Und München erhielt 1340 mit dem »Großen Stadtrecht« weitere Privilegien. In einer Zeit, in der Ludwig der Bayer vom Alten Hof aus auch als Kaiser im römisch-deutschen Reich herrschte, war München das Zentrum des Herzogtums Bayern, und in der Burgkapelle, der (im 19. Jahrhundert abgerissenen) Lorenzkapelle, wurden die Reichskleinodien aufbewahrt.


Nach dem Tod des erst elfjährigen Herzogs Johann von Niederbayern im Dezember 1340 wurde dessen Teilherzogtum wieder mit Oberbayern vereint. Ludwig der Bayer hatte 1324 in zweiter Ehe Margarete geheiratet, die älteste Tochter des Grafen Wilhelm III. von Holland-Hennegau. Als dieser 1337 starb, übertrug der Kaiser der Erbin auch die Reichslehen Holland, Seeland und Friesland. Und 1342 verheiratete er seinen verwitweten Sohn Ludwig V. von Brandenburg mit Margarete Maultasch, der »hässlichen Herzogin« von Tirol. Damit herrschte die Familie des Wittelsbacher Kaisers vorübergehend in Bayern, Tirol, Holland und Brandenburg.
München Stadtgeschichte 1347 ‒ 1525
München wird alleinige Residenzstadt Bayerns
Ludwig der Bayer starb 1347. Obwohl er nach wie vor dem Kirchenbann unterlag, erhielt er seine Grabstätte in der Frauenkirche, zunächst in der ursprünglichen und nach deren Abriss (1472) auch in der von Jörg Halsbach gebauten.
Weder die Königs- noch die Kaiserkrone konnte er in seiner Dynastie vererben, und die Kurwürde, die aufgrund eines Vertrags von 1329 zwischen der Rheinpfalz und Bayern wechseln sollte, übertrug der 1355 zum Kaiser gekrönte Karl IV. aus dem Haus Limburg-Luxemburg 1356 dem Wittelsbacher Pfalzgrafen Ruprecht I.
Album über die Frauenkirche
Nach Ludwigs Tod regierten seine sechs Söhne zunächst gemeinsam, aber 1349 (Landsberger Vertrag) bzw. 1353 (Regensburger Vertrag) teilten sie ihr Erbe auf. Die verschiedenen Teilungen endeten erst 1504 mit dem Landshuter Erbfolgekrieg, als der Münchner Herzog Albrecht IV. Bayern-Landshut eroberte und Kaiser Maximilian I. die Wiedervereinigung der Teilherzogtümer Ober- und Niederbayern 1505 bestätigte (Kölner Spruch). Albrecht IV. der Weise erließ 1506 ‒ weniger als zwei Jahre vor seinem Tod ‒ ein Primogeniturgesetz, demzufolge das Herzogtum Bayern fortan nicht mehr geteilt werden durfte, und die bayrischen Landstände stimmten dieser Regelung zu. München war fortan die alleinige Residenzstadt Bayerns.
Albrecht IV. der Weise war ein Sohn Herzog Albrechts III. des Frommen, der 1442 die Juden aus dem Herzogtum vertrieben hatte, aber mehr noch wegen seiner Liaison mit Agnes Bernauer bekannt ist. 1465 hatte Albrecht IV. als Mitregent seines älteren Bruders Siegmund die Herrschaft in Oberbayern übernommen, und seit Siegmunds Rückzug 1467 regierte er allein.
1487 erließ Herzog Albrecht IV. das Münchner Reinheitsgebot, das Wasser, Malz und Hopfen als einzige zulässige Zutaten des Münchner Bieres festlegte. Bemerkenswert ist, dass hier nicht die Stadt das Sagen hatte, wie bei anderen Gewerben, sondern der Landesherr. Der Hof in München verlieh für das gewerbsmäßige Bierbrauen in der Stadt Lizenzen (Regale) zu lehensrechtlichen Bedingungen.

Auf das Reinheitsgebot bezieht sich der Trinkspruch »Hopfen und Malz Gott erhalt’s«.
Der ist beispielsweise am 1958 von Joachim Berthold gestalteten »Bierbrunnen« am Oskar-von-Miller-Ring 1 zu lesen.
Album über die Geschichte des Münchner Biers
Die spätromanische dreischiffige Basilika, die 1271 zur zweiten Pfarrkirche in München geworden war, riss man 1472 ab, um Platz zu schaffen für einen Neubau, dessen Grundstein bereits 1468 gelegt worden war. Gestaltet wurde die neue spätgotische Frauenkirche von Jörg Halsbach (Jörg Ganghofer), der parallel dazu das → (Alte) Rathaus baute. Für den Dachstuhl der 109 Meter langen und 40 Meter breiten dreischiffigen Hallenkirche aus Backstein benötigte der Zimmermeister Heinrich aus Straubing 147 schwerbeladene Bauholzflöße (630 Festmeter). Die beiden Türme wurden mit Ausnahme der Hauben 1488 fertiggestellt, und 1494 wurde die Frauenkirche ‒ der spätere Dom zu Unserer Lieben Frau ‒ geweiht. Dabei handelt es sich um eine der drei größten Backsteinkirchen nördlich der Alpen. Die knapp hundert Meter hohen Türme der Frauenkirche mit den 1525 aufgesetzten »welschen« Renaissance-Hauben sind Münchens Wahrzeichen.

Album Frauenkirche
München Stadtgeschichte 1504 ‒ 1623
Bollwerk der Gegenreformation
Mit dem Ende der staatlichen Teilungen (1504) wurde München zum Verwaltungszentrum des bayrischen Herzogtums.
Herzog Albrecht IV. starb 1508. Sein Sohn und Nachfolger Wilhelm IV. von Bayern – der 1522 Maria Jacobaea von Baden (1507 – 1580) heiratete – verlegte seine Residenz vom → Alten Hof in die Neuveste, eine gotische Wasserburg im Nordosten der zweiten Stadtmauer, mit deren Bau 1385 begonnen worden war. (Daraus entstand im Lauf der Jahrhunderte die Münchner Residenz.) Dort empfing der bayrische Herzog 1530 Kaiser Karl V.

Herzog Wilhelm IV. von Bayern, 1526; Maria Jacobaea von Baden, Herzogin von Bayern, 1526
(Gemälde in der Alten Pinakothek München)
Während sich die Residenz zum glanzvollen Zentrum Münchens entwickelte, endete die Entfaltung der Stadtfreiheit. »Die Polypenarme des absolutistischen Staates legten sich um die bürgerliche Gemeinde, und die einst selbstverantwortliche Stadtpolitik wich mehr und mehr kleinlichem, engbrüstigem und devotem Untertanengetriebe.« (Michael Schattenhofer: Die Wittelsbacher als Stadtherren von München, in: Beiträge zur Geschichte der Stadt München, Hg. Historischer Verein von Oberbayern, München 1984, Seite 45) Ab 1450 entstanden in München neue zentrale Landesbehörden, durch die städtische Organe entmachtet wurden, und ein kurfürstlicher Stadtkommandant verfügte nun über die Torschlüssel.
Der Wittelsbacher Herzog Wilhelm IV. begründete den Ruf Münchens als Bollwerk der Gegenreformation (»deutsches Rom«).
1528 wurden neun Mitglieder einer kleinen Gemeinde der radikalreformatorischen Täufer in München hingerichtet, darunter drei Frauen. Durch die Gegenreformation entstanden neue Opfergruppen für die Berufshenker, die seit 1318 in München nachweisbar sind. Bis 1535 entschieden diese außerhalb der Gesellschaft stehenden Männer statt des Gerichts, ob sie die Verurteilten enthaupteten, henkten, räderten, ertränkten, verbrannten oder lebendig begruben.
Herzog Albrecht V. setzte den Kampf seines 1550 gestorbenen Vaters gegen die Reformation fort und gilt zugleich als einer der prunkvollsten Renaissancefürsten im Heiligen Römischen Reich. Während beispielsweise Erasmus Grasser und Jan Polack noch im Handwerk verwurzelt waren, also im Bürgertum, entwickelte sich die Kunst nun als Domäne des Hofes weiter.
1556 holte der Herzog Orlando di Lasso nach München und ernannte ihn 1564 zum Hofkapellmeister. Der flämische Komponist gilt neben dem Italiener Giovanni Pierluigi da Palestrina als Vollender der polyphonen Vokalmusik. In der bayrischen Hauptstadt erschien 1604, zehn Jahre nach seinem Tod, die erste Gesamtausgabe seiner Werke.
Denkmal für Orlando di Lasso am Promenadeplatz / Orlando-Haus am Platzl
1558 erwarb Herzog Albrecht V. die Bibliothek des im Jahr zuvor gestorbenen Gelehrten Johann Albrecht Widmanstetter, eine der bedeutendsten Bibliotheken in Europa, und gründete damit die Hofbibliothek im → Alten Hof, den Nukleus der heutigen Bayerischen Staatsbibliothek in München. Albrecht V. sammelte nicht nur Bücher, sondern auch antike Skulpturen. Für die Kunstsammlung errichteten der vom kaiserlichen Antiquar Jacopo Strado beratene Hofbaumeister Wilhelm Egkl und der Steinmetz Simon Zwitzel 1568 bis 1571 in der Münchner Residenz das 66 Meter lange → Antiquarium.
Statue von Herzog Albrecht V. im Treppenhaus der Bayerischen Staatsbibliothek
Wilhelm Egkl war 1559 von Herzog Albrecht V. zum Hofbaumeister ernannt worden. 1563 bis 1567 errichtete er einen Marstall, vermutlich nach Plänen von Simon Zwitzel. In den Obergeschossen des bedeutendsten Werks der Frührenaissance nördlich der Alpen richtete man die herzogliche Kunstkammer ein, die allerdings 1632 im Dreißigjährigen Krieg durch schwedische Truppen geplündert und 1807 aufgelöst wurde. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts baute man den Komplex zum Hauptmünzamt des Königreichs Bayern um (»Alte Münze«).
1559 folgten die ersten vier Jesuiten dem Ruf Albrechts V. und kamen nach München, wo sie zunächst im Augustinerkloster in der Neuhauser Straße unterkamen. Die Jesuiten wurden Beichtväter der herzoglichen Familie und übernahmen alle Gymnasien nicht nur in München, sondern in ganz Bayern. In großem Stil – im Kolleg, in der Kirche und auch »open air« – führten sie barocke Dramen in lateinischer Sprache auf (Jesuitentheater). Und im Kampf gegen die Reformation bildeten sie die Speerspitze. Aber die Jesuiten vermittelten nicht nur einen Wertekanon, sondern auch Disziplin, Bescheidenheit, Zurückhaltung und ein hohes Maß sowohl an Bildung als auch an Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein.
Papst Hadrian VI. sprach Bischof Benno von Meißen 1523 heilig. Einer Legende nach hatte der Kirchenfürst den Schlüssel zum Dom von Meißen in die Elbe geworfen, als er aus politischen Gründen geflohen war. Bei seiner Rückkehr soll er den Schlüssel beim Verzehr eines Fisches wiedergefunden haben. Martin Luther protestierte gegen die Heiligsprechung, und Anhänger des Reformators zerstörten 1539 das Grab Bennos im Meißener Dom. Daraufhin ließ Herzog Albrecht V. von Bayern die Gebeine bzw. Reliquien 1576 in die Münchner Frauenkirche bringen. Vier Jahre später wurde der hl. Benno zum Schutzpatron Münchens und Bayerns proklamiert.
Herzog Albrecht V. wollte sich ein Bild seines Territorium machen und beauftragte deshalb 1554 den Arzt, Mathematiker, Kartografen und Heraldiker Philipp Apian (1531 ‒ 1589), Johannes Aventinus‘ erste Karte von Bayern zu ergänzen. Zu diesem Zweck führte Philipp Apian sieben Jahre lang Landvermessungen durch und erstellte dann in zwei weiteren Jahren eine sechs mal sechs Meter große Karte (1563), von der er 24 Holzschnitte anfertigen ließ (»Bairische Landtafeln«, 1566). Parallel dazu schuf der Straubinger Drechslermeiter Jakob Sandtner von 1570 bis 1574 für Herzog Albrecht V. Modelle von München, Landshut, Ingolstadt und Burghausen.


Jakob Sandtners Modell von München ist im Bayerischen Nationalmuseum ausgestellt.
1561 übertrug Herzog Albrecht V. seiner Residenzstadt München die hohe Gerichtsbarkeit (Albertinischer Rezess). Das war ein großer Schritt in der Selbstverwaltung der Stadt.
Herzog Albrecht V. starb 1579, und sein Sohn Wilhelm V. erbte die Herrschaft. An dessen pompöse Hochzeitsfeier mit Renata von Lothringen, die 1568 in der Münchner Residenz stattgefunden hatte, erinnert noch heute das Glockenspiel am Neuen Rathaus.



Album übers Neue Rathaus
Der am 29. September 1548 ‒ am Festtag des Erzengels Michael ‒ in Landshut geborene Herzog ließ mitten in München 87 Häuser abreißen, um ab 1583 die Kirche St. Michael samt Kolleg für die Jesuiten bauen zu können. Die Entwürfe im Stil eines Übergangs von der Renaissance zum Barock stammen vermutlich von dem Niederländer Friedrich Sustris*, der 1573 nach München gekommen war. Wolf Miller und Wendel Dietrich leiteten 1583 bis 1597 die Bauarbeiten. Der 78 m lange und 32 m breite Innenraum wird von einem gewaltigen Tonnengewölbe beherrscht, dessen Dimensionen lediglich von denen des Peterdoms übertroffen werden. 1588 entstand die vom flämischen Bildhauer Hubert Gerhard** modellierte über drei Meter hohe Bronzefigur des Erzengels Michael an der Fassade. Geweiht wurde die Michaelskirche im Juli 1597, dreieinhalb Monate bevor Herzog Wilhelm V. abdankte, das Amt seinem Sohn Maximilian überließ und sich nach Schleißheim zurückzog.
*) Mehr zu Friedrich Sustris im Album über Architekten
**) Mehr zu Hubert Gerhard im Album über Kunst im öffentlichen Raum


Album über die Michaelskirche
München bildete unter Albrecht V., Wilhelm V. und Maximilian I. das Zentrum der Gegenreformation. Zwischen 1575 und 1591 wurden in München mehr als vierzig Menschen wegen religiöser Delikte hingerichtet, und 1590 begannen die Hexenprozesse mit den Todesurteilen des Stadtoberrichters Christoph Riemhofer gegen Anna und Brigitta Anbacher, Regina Lutz und Regina Pollinger, die sich angeblich vom Teufel hatten beschlafen lassen. Allein im Zuge eines Prozesses gegen die Landstreicherfamilie Gämperle bzw. Pappenheimer im Jahr 1600 verbrannte man ein Dutzend »Hexen« und »Hexer« auf dem Scheiterhaufen. Aber auch noch 1701, unter Kurfürst Max Emanuel, wurde die 17-jährige Wachtmeistertochter Maria Theresia Käser enthauptet. (Das war die letzte in München nachweisbare Hinrichtung einer »Hexe«.)
Herzog Wilhelm V. hob die lukrativen von Kaiser Ludwig IV. verbrieften Salzprivilegien der Stadt München 1587 auf und begründete stattdessen ein herzogliches Salzhandelsmonopol.
1589 ordnete Herzog Wilhelm V. den Bau eines Hofbräuhauses in München an. Das ab 1591 zwischen → Altem Hof und Pfisterbach (heute: Sparkassenstraße) gebraute Bier war der Hofgesellschaft vorbehalten, denn es sollten die Ausgaben für den Bierkonsum in der Residenz gespart werden. 1607/08 ließ Maximilian I. die 1585 von seinem Vater am später »Platzl« genannten Ort eingerichtete Glashütte abreißen, um ein weiteres Hofbräuhaus zu bauen, und ab 1610 durften auch nicht zum Hof gehörende Bürger dort Bier kaufen.
Album über die Geschichte des Münchner Biers
Um 1600 betrug die Einwohnerzahl Münchens 18.000. Davon gehörten Tausende zum Hofstaat. Sie belebten zwar als Konsumenten und Auftraggeber von Dienst- bzw. Handwerkerleistungen das Wirtschaftsleben, trugen jedoch ‒ ebenso wie Klerus und Aristokratie ‒ nichts zum Steueraufkommen der Stadt bei. (Im Kreuzviertel waren hundert Jahre später nur noch 105 von 235 Häusern im Besitz von Stadtbürgern.)
1581 bis 1600 gestaltete der Architekt Friedrich Sustris* das Antiquarium in der Residenz zum Fest- und Bankettsaal um. Herzog Maximilian I. ließ die Münchner Residenz in Vorwegnahme seiner späteren (1623) Erhebung zum Kurfürsten in zwei Bauphasen von 1600 bis 1605 und 1612 bis 1616 mit dem Kaiserhof sowie den Prunkzimmern, der Hofkapelle und der Reichen Kapelle zum größten Renaissanceschloss in Deutschland erweitern.
Stuckmarmor gab es zwar bereits in der Spätantike, aber den Höhepunkt erreichte die Scagliola-Technik (Gipsintarsien) erst im 17. Jahrhundert in der Münchner Residenz, und Maximilian I. beanspruchte dafür ein Monopol: Die Handwerker mussten ihr Wissen darüber geheim halten.
*) Mehr zu Friedrich Sustris im Album über Architekten
Album Residenz-Museum
Noch als Herzog ließ Maximilian I. 1610 eine Medaille prägen, die Maria als Schutzherrin der Stadt München darstellte, und 1616 proklamierte er sie mit einer überlebensgroßen, von Hans Krumpper* gestalteten Bronzestatue an der Residenz zur offiziellen Schutzheiligen Bayerns (»Patrona Boiariae«).
*) Mehr zu Hans Krumpper im Album über Kunst im öffentlichen Raum
Das von Herzog Wilhelm V. Ende des 16. Jahrhunderts in Schleißheim errichtete Herrenhaus (»Wilhelmsbau«) ließ sein Sohn Maximilian bis auf die Kellermauern abreißen und 1617 bis 1623 durch ein Renaissance-Schloss ersetzen (»Altes Schloss«).

Album Schlossanlage Schleißheim
München Stadtgeschichte 1608 ‒ 1638
München im Dreißigjährigen Krieg
Nachdem sich die Protestanten 1608 in einer »Union« zusammengeschlossen hatten, gründete der bayrische Herzog Maximilian I. im Auftrag des Kaisers 1609 die katholische »Liga«. Als Vorkämpfer der Liga zog er in den Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) und trug die finanzielle Hauptlast des Krieges. Kaiser Ferdinand II. erhob seinen treuen Mitstreiter Maximilian I. 1623 zum Kurfürsten, und fünf Jahre später belehnte er ihn zudem mit der Oberpfalz.



Erste Feldgeschütze waren bereits in den Hussitenkriegen (1419 – 1439) zum Einsatz gekommen. Als 1618 der Dreißigjährige Krieg begann, ordnete Maximilian die Befestigung Münchens durch einen 30 Meter breiten Wall mit vorspringenden Bastionen an, denn die bestehende Stadtmauer hätte einem Angriff mit Geschützen nicht standhalten können. Mit dem Bau wurde 1619 begonnen, aber als die Schweden im Mai 1632 vor München aufmarschierten, war erst der nördliche Teil der Wallbefestigung fertig.
Der protestantische schwedische König Gustav Adolf drohte mit einem Angriff, bis ihm der Magistrat symbolisch die Stadtschlüssel aushändigte und er durchs → Isartor reiten konnte. Der Kurfürst befand sich im Feldlager bei Regensburg, und der Hof hatte sich nach Salzburg abgesetzt. Während die Schweden auf ihrem Kriegszug in zahlreichen Dörfern gewütet hatten, blieb München unzerstört, weil der Magistrat ein Lösegeld versprach, dessen Betrag so hoch war, dass während der dreiwöchigen Besatzung Münchens nur ein Drittel davon aufgebracht werden konnte. Deshalb sperrten die Schweden 42 Geiseln aus München in Augsburg ein. In Laim erinnern heute noch Straßennamen an Geiseln wie Melchior Camerloher, Johann Lanz, Georg Perhamer, Franz Sigl und Johann Stöberl. (1635 kamen die Geiseln frei, obwohl die volle Lösegeld-Summe noch nicht bezahlt war.)
Gustav Adolf fiel im November 1632, aber der Krieg ging auch in Bayern bis zum Westfälischen Frieden im Oktober 1648 weiter.
Zwei Jahre nach der schwedischen Invasion starb ein Drittel der Münchner Bevölkerung (7000 von 23.000 Einwohnern) während einer Pestepidemie, und weil die Menschen weder etwas von Hygiene noch von Bakterien und Infektionen wussten, hielten sie Juden für die Verursacher.
Kurfürst Maximilian I. kehrte 1637 zurück nach München und ließ im Jahr darauf die → Mariensäule auf dem Markt- bzw. Schrannenplatz aufstellen, zum Dank dafür, dass München im Dreißigjährigen Krieg unzerstört geblieben war – aber auch, um seine Macht zu demonstrieren, denn der Platz vor dem → (Alten) Rathaus war ein Symbol der Freiheit und Selbstverwaltung der Bürger, und der Herrscher hatte kein Recht, dort etwas zu verändern. Die Marienstatue, die bis 1613 für den Hochaltar der Frauenkirche verwendet worden war, soll der flämische Bildhauer Hubert Gerhard* ursprünglich für die Michaelskirche geschaffen haben.
*) Mehr zu Hubert Gerhard im Album über Kunst im öffentlichen Raum
Mariensäule auf dem Münchner Marienplatz
München Stadtgeschichte 1651 ‒ 1679
Kurfürst Ferdinand Maria und Kurfürstin Henriette Adelheid
Als Kurfürst Maximilian I. im September 1651 starb, war der Thronfolger Ferdinand Maria noch keine 15 Jahre alt – aber bereits seit Dezember 1650 per procurationem mit der gleichaltrigen Henriette Adelaide von Savoyen verheiratet. Erst im Mai 1652 reiste die bayrische Kurfürstin von Turin ab; Ferdinand Maria kam ihr entgegen, und in Kufstein sah sich das Ehepaar zum ersten Mal. Stellvertretend für den noch minderjährigen Kurfürsten Ferdinand Maria führte dessen Mutter die Regierungsgeschäfte noch bis 1654.
Der Gelehrte Johann Joachim Becher, der 1664 bis 1670 als Arzt und Mathematiker am Hof des bayrischen Kurfürsten in München wirkte, schlug allen Ernstes vor, eine bayrische Kolonie an der amerikanischen Ostküste zu gründen und zu diesem Zweck Manhattan von den Holländern zu erwerben. Aber 1667 fiel Nieuw Amsterdam an die Briten, die daraus New York machten.
Als Kurfürstin Adelheid 1662 endlich einen Sohn gebar, erfüllte sie ihr drei Jahre zuvor abgelegtes Gelübde, nach der Geburt eines Erbprinzen eine Kirche bauen zu lassen. Ein Bauplatz gegenüber der Münchner Residenz wurde ausgewählt, und der aus Bologna stammende Hofbaumeister Agostino Barelli* entwarf nach dem Vorbild der Theatinerkirche Sant’Andrea della Valle in Rom das Bauwerk. Enrico Zuccalli*, der ihn 1669 ablöste, vollendete die 71 m hohe Kuppel über der Vierung und fügte die beiden Türme hinzu. Mit der Theatinerkirche St. Kajetan und Adelheid wurde 1690 die erste im Stil des italienischen Hochbarocks erbaute Kirche in Altbayern fertiggestellt. (Die Rokokofassade gestalteten Francois Cuvilliés d. Ä.* und sein gleichnamiger Sohn 1765 bis 1768.)
*) Mehr zu Agostino Barelli, Francois Cuvilliés und Enrico Zuccalli im Album über Architekten
Theatinerkirche St. Kajetan und Adelheid / Kurfürstin Adelheid an der Kirchenfassade
Album über die Theatinerkirche
Parallel dazu erwarb der über den Thronfolger glückliche Kurfürst Ferdinand Maria ab 1663 die Hofmark Kemnaten östlich des Schlosses → Blutenburg und ließ dort 1664 bis 1675 für seine Gemahlin Adelheid ein Landschloss errichten, dem sie den Namen »borgo delle nimfe« (»Nymphenburg«) gab.
Aber die Freude dauerte nicht lang: Als die Münchner Residenz 1674 brannte, rettete Kurfürstin Adelheid ihre Kinder und erkältete sich dabei so heftig, dass sie sich nicht mehr davon erholte, sondern im März 1676 verschied. Die Fertigstellung der Theatinerkirche erlebte sie also nicht mehr.
1679 starb auch Ferdinand Maria im Alter von 42 Jahren und wurde ebenso wie Adelheid in der Theatinerkirche bestattet.
München Stadtgeschichte 1679 ‒ 1726
Kurfürst Maximilian II. Emanuel
Kurfürst Maximilian II. Emanuel, der älteste Sohn des verstorbenen Kurfürstenpaars, kam dem Habsburger Kaiser Leopold I. militärisch zu Hilfe, als die Osmanen 1683 Wien belagerten (Großer Türkenkrieg) und kämpfte persönlich mit. Auch nach der Befreiung Wiens bewährte sich der »blaue Kurfürst« weiter als Feldherr des Kaisers. Beispielsweise gelang ihm 1688 nach vierwöchiger Belagerung die Befreiung Belgrads, und das festigte sein Renommee als Türkenbezwinger.

Max Emanuel heiratete am 15. Juli 1685 Maria Antonia von Österreich, die Tochter Kaiser Leopolds I. (1640 – 1705). Damit bot sich den Wittelsbachern eine Chance, die Habsburger zu beerben. Noch einen Schritt näher kam Kurfürst Max Emanuel seinem Ziel, als ihn der aus dem Hause Habsburg stammende spanische König Karl II. im Dezember 1691 zum Generalstatthalter der Spanischen Niederlande ernannte und er bis 1700 in Brüssel statt in München residierte.
Kurfürstin Maria Antonia starb am 24. Dezember 1692 ‒ knapp zwei Monate nachdem sie einen Sohn geboren hatte. Dieser wurde 1698 vom kinderlosen spanischen König Karl II. als Erbe eingesetzt, und der bayrische Kurfürst Max II. Emanuel malte sich bereits aus, dass sein Sohn Joseph Ferdinand auch das spanische Weltreich beherrschen würde. Aber der Kurprinz starb 1699 im Alter von sechs Jahren.
Kurfürst Joseph Clemens von Köln, ein jüngerer Bruder des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern, kam als Fürstbischof von Freising in den Besitz der geistlichen Hofmark Berg am Laim und ließ sich dort von Enrico Zuccalli* für seine Aufenthalte in bzw. bei München ein befestigtes Schloss errichten, nach dem 1701 auch der Ort benannt wurde: Josephsburg.
Kurz vor seinem Tod im November 1700 bestimmte der Habsburger Karl II. in Madrid den Bourbonen Philipp von Anjou als Nachfolger. Das nahmen der Kaiser in Wien, aber auch England, die Niederlande und Preußen nicht hin: Sie verbündeten sich Ende 1701 gegen Frankreich (Haager Große Allianz), und damit begann der Spanische Erbfolgekrieg (1701 ‒ 1714), in den beinahe alle europäischen Staaten hineingezogen wurden.
Max Emanuel, der sich 1701 zusammen mit seinem Bruder Joseph Clemens dem »Sonnenkönig« Ludwig XIV. von Frankreich angeschlossen hatte, floh 1704 nach der vernichtenden Niederlage des französisch-bayrischen Heeres in der Zweiten Schlacht von Höchstädt/Blindheim ins flandrisch-französische Exil, während die Habsburger Bayern und auch München besetzten (Kaiserliche Administration). 1706 verhängte Kaiser Joseph I. unter Einbeziehung der Reichsgerichte und mit Zustimmung der anderen Kurfürsten die Reichsacht über Max Emanuel.
Im Dezember 1705 – lange vor der französischen Revolution – bildete sich in Braunau am Inn ein bayrischer »Landesdefensionskongress«, in dem Vertreter der Bauern, der Stadtbürger und des Adels Rede- und Stimmrechte hatten. Dieses »Braunauer Parlament« rief zum Volksaufstand gegen die Besatzung auf und stellte dafür Truppen.
In der Nacht vom 24./25. Dezember 1705 verschanzten sich Aufständische in Sendling vergeblich vor der Reichsarmee unter dem Oberbefehl des Habsburger Kaisers Joseph I. Obwohl sich die Rebellen schließlich der Übermacht ergaben, wurden mehr als tausend von ihnen niedergemetzelt (Sendlinger Mordweihnacht).
*) Mehr zu Enrico Zuccalli im Album über Architekten


Vorbild für die legendäre Figur des Schmieds von Kochel könnte Balthasar Riesenberger gewesen sein. Der war Schmied und kam nachweislich in der Sendlinger Mordweihnacht ums Leben. Allerdings war er nicht aus Kochel, sondern aus Bach in der Gemeinde Weyarn.
An der alten Kirche St. Margaret in Sendling befindet sich ein 1830 von Wilhelm Lindenschmit d. Ä. gemaltes Fresko mit einer Szene aus der Sendlinger Bauernschlacht, und auf der gegenüberliegenden Seite der Lindwurmstraße erinnert ein 1905 – 1911 von Carl Ebbinghaus und Carl Sattler geschaffenes Denkmal an den Schmied von Kochel.
1714 endete der Spanische Erbfolgekrieg, und im Januar 1715 verließen die letzten kaiserlichen Truppen München. Die Franzosen setzten die Restitution Max Emanuels als Kurfürst von Bayern durch, und der Wittelsbacher kehrte im April aus dem Exil nach München zurück.
Dort ließ Max II. Emanuel die Bautätigkeit wieder aufleben.
Max Emanuels Hofbaumeister Giovanni Antonio Viscardi* fing 1702 damit an, Schloss Nymphenburg zur barocken Schlossanlage zu erweitern. Sein Nachfolger Joseph Effner* fuhr 1715/16 damit fort. Von ihm stammen auch die → Pagodenburg, die → Badenburg und die → Magdalenenklause im 200 Hektar großen Schlosspark. (Die → Amalienburg ließ Kurfürst Karl Albrecht 1734 bis 1739 von François de Cuvilliés* als Jagd- und Lustschlösschen für seine Frau Amalia gestalten.)
*) Mehr zu François de Cuvilliés, Joseph Effner und Giovanni Antonio Viscardi im Album über Architekten
Alben über den Schlosspark Nymphenburg bzw. das Schloss Nymphenburg
In Schleißheim, wo Max Emanuel bereits 1683 bis 1689 das → Schloss Lustheim hatte bauen lassen, war 1701 der Grundstein einer Residenz nach dem Vorbild des Schlosses von Versailles gelegt worden, aber während des Spanischen Erbfolgekriegs ruhten die von Enrico Zuccalli* begonnenen Arbeiten. Nach seiner Rückkehr beauftragte Max Emanuel seinen Baumeister Joseph Effner* 1719 mit der Errichtung des Neuen Schlosses, das nun allerdings bescheidener ausfiel als ursprünglich geplant.
*) Mehr zu Joseph Effner und Enrico Zuccalli im Album über Architekten

Album über die Schlossanlage Schleißheim
Max Emanuel erwarb 1715 eine Schwaige südwestlich von München und ließ das Herrenhaus von Joseph Effner bis 1717 zu einem Jagdschloss mit Barockgarten umgestalten: Schloss Fürstenried. Parallel dazu gestaltete der Baumeister 1715 bis 1717 das Schloss Dachau für den Kurfürsten um.

Album über Schloss Fürstenried
Joseph Effner* orientierte sich nicht mehr an italienischen Bauwerken, sondern übernahm französische Vorstellungen der Baukunst (Régence) und entwickelte den süddeutschen Barock. François de Cuvilliés*, der 1708 als Hofzwerg in die Dienste des Kurfürsten Max II. Emanuel getreten war und 1720 bis 1724 auf dessen Geheiß die Pariser Académie royale d’architecture besucht hatte, bevor er neben Joseph Effner zum Hofbaumeister ernannt wurde, entwickelte sich zum bedeutendsten Baumeister des deutschen Rokoko.
*) Mehr zu François de Cuvilliés und Joseph Effner im Album über Architekten
München Stadtgeschichte 1726 ‒ 1745
Karl Albrecht von Bayern: Österreichischer Erbfolgekrieg
Der verschwenderische Kurfürst Max II. Emanuel starb 1726. Sein Sohn Karl Albrecht von Bayern folgte ihm als Herrscher, zunächst als Kurfürst und 1741 bis 1743 auch als König von Böhmen. Von 1742 bis zu seinem Tod drei Jahre später regierte der Wittelsbacher außerdem als Kaiser Karl VII. das Heilige Römische Reich.
1729 brannten die ab 1725 von Joseph Effner* angebauten Räume der Münchner Residenz aus. Als Ersatz schuf François Cuvilliés* 1730 bis 1737 die sog. Reichen Zimmer im Rokoko-Stil.
*) Mehr zu François de Cuvilliés und Joseph Effner im Album über Architekten
Album über die Münchner Residenz
Während der gesamten Regierungszeit des Kurfürsten Karl Albrecht befand sich Bayern im Krieg gegen Österreich. Der Habsburger Kaiser Karl VI. war 1740 in Wien gestorben und aufgrund der Pragmatischen Sanktion (1713) von seiner Tochter Maria Theresia beerbt worden. Sowohl Karl Albrecht als auch Philipp V. von Spanien und der sächsische Kurfürst Friedrich August II. machten dagegen eigene Ansprüche geltend, und Friedrich der Große nutzte das, um als Gegenleistung für die preußische Anerkennung der Pragmatischen Sanktion ultimativ von Maria Theresia Schlesien zu fordern und dort einzumarschieren (Erster Schlesischer Krieg, 1740 – 1742). Im Vertrag von Nymphenburg schlossen sich Bayern und Spanien 1741 dem preußisch-französischen Bündnis an, und es entwickelte sich der Österreichische Erbfolgekrieg (1740 – 1748), in den aufgrund anderer Konflikte auch Großbritannien und die Vereinigten Niederlande eingriffen.
Kurfürst Karl Albrecht marschierte im Juli 1741 in Österreich ein. Die Bayern zogen die Donau hinunter, wandten sich dann aber statt nach Wien nach Prag und eroberten die Stadt im November. Dort ließ sich Karl Albrecht im Dezember zum böhmischen König krönen.
Aber zwölf Tage, nachdem er sich am 12. Februar 1742 von seinem Bruder Klemens August, dem Kurfürsten von Köln, im Frankfurter Dom als Kaiser Karl VII. hatte krönen lassen, besetzten die Österreicher München, und im Juni 1743 wurde Bayern erneut österreichischer Verwaltung unterstellt. Erst als die Österreicher von dort vertrieben wurden, konnte Kaiser Karl VII. im Oktober 1744 von Frankfurt nach München zurückkehren. Bevor die Besatzer München verließen, brannten sie die damals einzige Isarbrücke zwischen Tölz und Freising nieder (→ Ludwigsbrücke).
Zwölf Tage nachdem sich Österreich, Sachsen-Polen, die Vereinigten Niederlande und Großbritannien gegen Preußen verbündet hatten (Warschauer Quadrupel-Allianz), starb Kaiser Karl VII. am 20. Januar 1745 auf Schloss Nymphenburg.

München Stadtgeschichte 1745 ‒ 1777
Kurfürst Max III. Joseph
Karl Albrechts einziger Sohn Maximilian III. Joseph sah schon bald die Aussichtslosigkeit der bayrischen Großmacht-Ambitionen ein und schloss im April 1745 einen Sonderfrieden mit Österreich, der ihm trotz militärischer Niederlagen den Erhalt Bayerns sicherte. Im Gegenzug erkannte der Wittelsbacher die Pragmatische Sanktion an und sicherte Maria Theresia zu, bei der anstehenden Kaiserwahl für ihren Ehemann Franz Stephan von Lothringen zu stimmen, der dann auch im September als Franz I. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches avancierte.
Der Österreichische Erbfolgekrieg endete 1748 mit dem Aachener Frieden. Preußen erhielt mit Schlesien eine der reichsten Provinzen Österreichs und stieg zur europäischen Großmacht auf. Österreich hatte sich 1746 noch mit Russland verbündet, aber diese gegen Preußen, Frankreich und Schweden gerichtete Allianz kam erst im Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763) zum Tragen.
Kurfürst Max III. Joseph förderte Kunst und Wissenschaft. Er gründete 1759 die Kurfürstliche Akademie der Wissenschaften in München und 1770 mit der »Hofschule« die spätere Kunstakademie (Akademie der Bildenden Künste München).
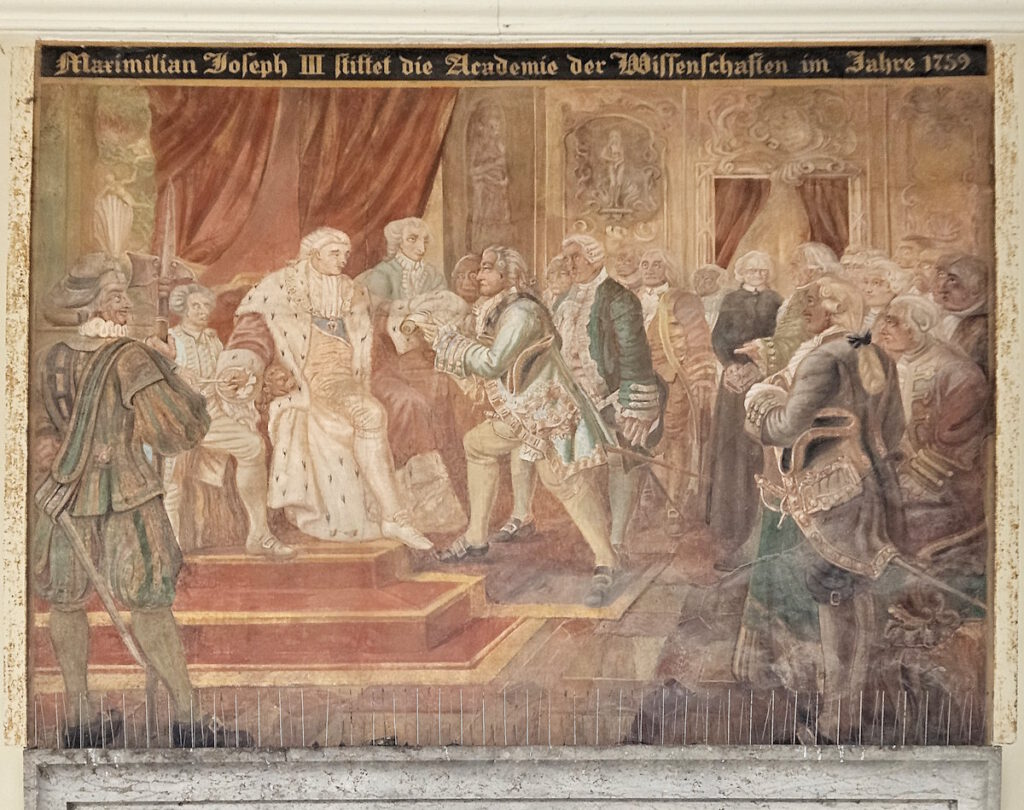
Nach der aufwändigen Bautätigkeit seiner Vorgänger fehlte es Max III. Joseph an finanziellen Mitteln, und ein von François de Cuvilliés* entworfener neuer Ostflügel der Residenz konnte deshalb nicht realisiert werden. Immerhin ließ Max III. Joseph von François de Cuvilliés und dessen Schüler Karl Albert von Lespilliez 1751 bis 1753 anstelle des 1750 durch ein Feuer zerstörten St.-Georg-Theatersaals in der Residenz auf dem Areal eines abgerissenen Klosters neben der Residenz ein neues errichten, das als das bedeutendste Rokoko-Theater in Deutschland gilt (→ Cuvilliés-Theater).
*) Mehr zu François de Cuvilliés im Album über Architekten
Album über die Münchner Residenz / Album über Theatergeschichte
Der aus der ersten Bauzeit des Schlosses Nymphenburg stammende Steinerne Saal (Festsaal) im Mittelpavillon wurde 1755 bis 1758 von François de Cuvilliés dem Älteren im Rokoko-Stil umgestaltet, und Johann Baptist Zimmermann* schuf den von Stuckaturen eingefassten Freskenzyklus. Außerdem vollendete François de Cuvilliés der Jüngere 1768 die Rokoko-Fassade der Theatinerkirche nach Plänen seines Vaters.
*) Mehr zu François de Cuvilliés und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten
Album über Schloss Nymphenburg
Klemens August von Wittelsbach, ein Sohn Max Emanuels, der seinen Onkel Joseph Clemens als Kurfürst von Köln beerbte, ließ 1738 bis 1751 von Johann Michael Fischer* in seiner Hofmark Berg am Laim die Hofkirche → St. Michael errichten. Anfangs baute der Polier Philipp Jakob Köglsperger an der Doppelturmfassade, aber dann übernahm der Architekt selbst die Bauleitung. François de Cuvilliés* wirkte als Bauinspektor mit, und Johann Baptist Zimmermann* schuf 1743 bis 1744 die Deckenmalereien und Stuckaturen. Schnitzarbeiten stammen von Ignaz Günther und Johann Baptist Straub.
*) Mehr zu François de Cuvilliés, Johann MIchael Fischer und Johann Baptist Zimmermann im Album über Architekten

1770 ächtete Kurfürst Max III. Joseph jedoch das Rokoko und verordnete den Kirchen statt des Zierrats »edle Simplicität«. Damit bahnte er den Weg für den Klassizismus ‒ und entzog Stukkateuren die Wirtschaftsgrundlage.
Im selben Jahr beauftragte der Münchner Magistrat den Maler Franz Gaurapp, einen Enkel von Cosmas Damian Asam, jede Haustür mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen. Das Kreuzviertel bekam 246 Hausnummern, das Hackenviertel 306, das Angerviertel 324 und das Graggenauer Viertel 337. Die Münchner kümmerten sich allerdings wenig um das neue System. Statt eine Hausnummer bei der Adressenangabe zu nutzen, fuhren sie mit den gewohnten umständlichen Beschreibungen fort: »in dem ehemalig gewesten Metzger-, nunmehr Branntweiner-, vulgo Schalterhaus auf dem Kreuz, grad gegenüber der Kirch« (zit. nach Michael Schattenhofer).
Als Anhänger des Absolutismus versuchte Max III. Joseph, Kirche, Stände, Märkte und Städte zu kontrollieren. Dass der Papst 1773 den Jesuitenorden aufhob, kam ihm gelegen. Die Aufklärung begann zwar auch in Bayern den Absolutismus abzulösen, aber die Reform des Rechtssystems blieb hinter den Fortschritten in Preußen und Österreich zurück: Delikte wie Häresie und Hexerei wurden in Bayern ebenso wenig abgeschafft wie Folter und grausame Hinrichtungsmethoden.
Bei Wolfgang Amadeus Mozart in Salzburg bestellte Kurfürst Max III. Joseph für den Fasching 1775 eine Oper. »La finta giardiniera« wurde am 13. Januar 1775 in München uraufgeführt. Zwei Jahre später, als Mozart auf einer Reise nach Paris erneut durch München kam, passte er mit Hilfe eines Gönners den Kurfürsten ab und bat um eine Anstellung in der bayerischen Residenzstadt. Max III. Joseph erklärte jedoch kurzerhand, es gebe keine »vaccatur«. (Im Mozart-Jahr 2006 wurde am Lesmüllerhaus eine vom Bildhauer Hubertus von Pilgrim* gestaltete Gedenktafel an Mozarts Aufenthalte in München enthüllt.)
*) Mehr zu Hubertus von Pilgrim im Album über Kunst im öffentlichen Raum
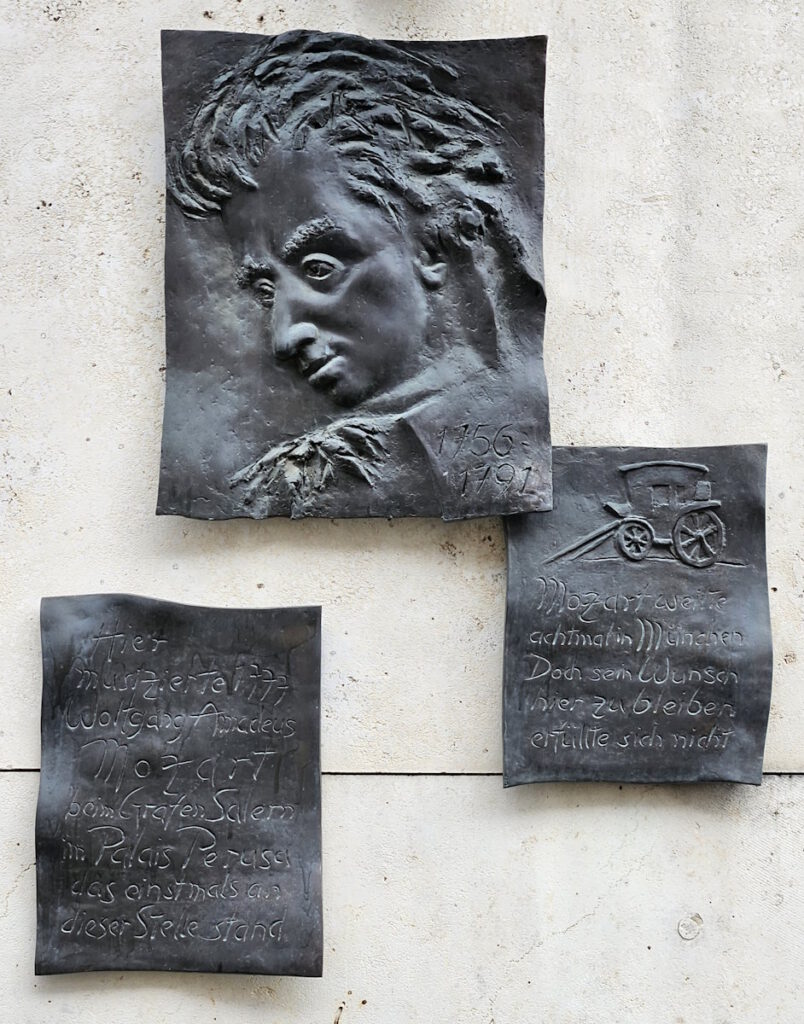
Max III. Joseph starb 1777 an Pocken, und weil es in der bayrischen Linie der Wittelsbacher keinen Erben gab, wurden die seit 1329 getrennten Linien Pfalz und Altbayern nun gemäß dem Hausvertrag von Pavia (1329) wieder vereinigt.
München Stadtgeschichte 1777 ‒ 1799
Kurfürst Karl Theodor
Kurfürst Karl Theodor, der seine frühe Kindheit in Brüssel verbracht und Deutsch als Fremdsprache gelernt hatte, verließ 1777 im Alter von 53 Jahren seine Residenzstadt Mannheim und zog widerwillig nach München, um von dort aus weiterzuregieren. Seinen Hofstaat einschließlich der pfälzischen Räte brachte er mit, und 1778 wurde München Residenzstadt von Kurpfalz-Bayern.



Mit Kaiser Joseph II. und dessen Mutter Maria Theresia verhandelte Karl Theodor heimlich über einen Gebietstausch. 1778 überließ er ihnen sowohl Teile der Oberpfalz als auch Niederbayerns und beanspruchte dafür Vorderösterreich und die Niederlande. Bevor die Unterschriften unter dem Schriftstück trocken waren, besetzte Kaiser Joseph II. seine neuen Gebiete. Das nahm Friedrich der Große nicht hin und erzwang im Bayerischen Erbfolgekrieg (1878/79) ohne eine einzige Schlacht eine Neuregelung: im Teschener Frieden begnügte sich Österreich 1779 mit dem bayrischen Innviertel. Der Dualismus zwischen Preußen und Österreich ging mit einem Bedeutungsverlust Bayerns einher.
1785 versuchte es Karl Theodor erneut und strebte dieses Mal sogar einen Tausch ganz Bayerns gegen die Österreichischen Niederlande an, die er als »König von Burgund« regieren wollte, aber auch dieses Vorhaben wurde von Preußen ohne Blutvergießen vereitelt. Beliebt machte sich Karl Theodor mit seinen Plänen in München nicht.
1782 hatte Kurfürst Karl Theodor den ersten nach München gereisten Papst empfangen, und gegen den Protest der Erzbischöfe von Köln, Trier, Mainz und Salzburg entstand 1785/86 eine Nuntiatur in München.
1788 trugen der Münchner Bürgermeister und einige Stadträte dem Kurfürsten Beschwerden der Bürgerschaft vor. Aufgebracht zog Karl Theodor daraufhin mit einem Großteil des Hofes nach Mannheim. Weil die Münchner Gewerbetreibenden jedoch nicht auf die Kaufkraft der Hofbediensteten verzichten wollten, reiste ihm eine Gesandtschaft nach, und der Kurfürst kehrte nach acht Monaten wieder zurück. In München rumorte es allerdings weiter. 1791 ersetzte Karl Theodor den Münchner Stadtrat vorübergehend durch eine kurfürstliche Administration, und die rebellischen Stadträte mussten in der Herzog-Max-Burg vor einem Gemälde des Kurfürsten kniefällig Abbitte leisten. Durch eine vom Kurfürsten in einem Wahlbrief 1795 bestätigte Änderung der Stadtverfassung wurden den 36 Mitgliedern des Stadtrats ebenso viele von den Zünften gewählte Repräsentanten zur Seite gestellt.
Mitte der Achtzigerjahre kam der britische Offizier, Waffentechniker und Physiker Sir Benjamin Thompson, der auch einige Jahre in den USA verbracht hatte, nach München und wurde Ehrenmitglied der Kurbayerischen Akademie der Wissenschaften. 1788 avancierte der General zum Kriegsminister und machte sich daran, die bayrische Armee zu reorganisieren.
In diesem Zusammenhang begann er 1789, den zunächst als Musterlandwirtschaft für die Versorgung der Soldaten konzipierten Englischen Garten anzulegen ‒ nicht zuletzt mit skeptisch beäugtem Kartoffelanbau. Für die Gestaltung holte man Friedrich Ludwig Sckell* aus Schwetzingen. Dem jungen Landschaftsgärtner hatte es ein kurfürstliches Stipendium ermöglicht, Barockgärten in Frankreich und Landschaftsparks in England zu besichtigen. Mit dieser Erfahrung arbeitete Friedrich Ludwig Sckell in München, und 1793 konnte der Englische Garten der Öffentlichkeit übergeben werden. Die Münchner gingen jedoch zunächst nicht in den Anlagen spazieren, denn das hielten sie damals für Müßiggang und eine höfische (Un-)Sitte.
Der → Chinesische Turm im Englischen Garten entstand 1789/80 als Aussichts- und Musikpagode. Joseph Frey (Entwurf) und Johann Baptist Lechner (Bauingenieur) orientierten sich dabei an der Majolika-Pagode in Peking. Solange die Bäume im Englischen Garten noch klein waren, diente das 25 Meter hohe Holzbauwerk als Aussichtsplattform. In der Nähe ließ Benjamin Thompson 1790 bis 1792 nach Plänen des Offiziers und Architekten Johann Baptist Lechner ein klassizistisches Offizierskasino im Englischen Garten bauen (»Rumfordschlössl«).
*) Mehr zu Friedrich Ludwig von Sckell im Album über Architekten




Album über den Englischen Garten
Für 1318 ist ein erster öffentlicher Brunnen in München nachweisbar: der Marktbrunnen. Dort war dann auch 1343 der erste Laufbrunnen gebaut worden. 1467 bis 1471 wurde eine Rohrleitung aus durchbohrten Holzstangen von Thalkirchen ins Stadtzentrum verlegt, um den Laufbrunnen am Schrannenplatz zu speisen. Bis ins 19. Jahrhundert bestanden Wasserrohre aus Holz.
Jahrhundertelang versorgten sich die meisten Münchner an Zieh- oder Schöpfbrunnen mit Grundwasser. Im 17. Jahrhundert kamen zwar Pumpbrunnen auf, aber das änderte nichts daran, dass mit dem Wasser Schadstoffe aufgenommen wurden, solange es keine Kanalisation gab. (Erst der Hygieniker Max von Pettenkofer* sorgte im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts für grundlegende Verbesserungen.)
Bis ins 18. Jahrhundert unterschied man zwischen privaten und öffentlichen Brunnen (»Stadtbrunnen«). Die meisten dieser Stadtbrunnen standen nur den Bewohnerinnen und Bewohnern einer Gruppe von benachbarten Häusern zur Verfügung (»Brunn-Gemein«).
Aufgrund der Seuchengefahr ließ Kurfürst Karl Theodor 1788/89 alle innerstädtischen Friedhöfe in München schließen und einen seit 1563 existierenden Pest-Friedhof außerhalb des → Sendlinger Tors zum »Centralfriedhof« umgestalten (heute: → Alter Südfriedhof). Der blieb dann bis 1868 die einzige Begräbnisstätte Münchens. Als erster Protestant wurde der aus Mannheim stammende Münchner Wein- und Pferdehändler Johann Balthasar Michel 1818 auf dem Alten Südfriedhof bestattet.
*) Mehr zu Max von Pettenkofer im Album über Denkmäler


1791 baute Benjamin Thompson das Neuhauser Tor um, schleifte die Bastion und legte den »Neuhauser-Tor-Platz« neu an. Im Jahr darauf wurde das Neuhauser Tor zu Ehren des bayrischen Kurfürsten in Karlstor umbenannt, aber erst fünf Jahre später genehmigte Karl Theodor die Bezeichnung »Karlsplatz«. Parallel dazu setzte sich der von den Münchnern bevorzugte Name → »Stachus« durch, der auf den Wirt Mathias Eustachius Föderl zurückgeht.
Obwohl Benjamin Thompson die Lebensumstände der Bevölkerung zum Beispiel durch Armen- und Arbeitshäuser, Suppenküchen (»Rumfordsuppe«), Schulen und Manufakturen zu verbessern versuchte, mochten ihn die Münchner ebenso wenig wie den Kurfürsten. Der nutzte allerdings 1792 die Monate, in denen er als Vikar des Heiligen Römischen Reiches amtierte, um den Kriegsminister und Polizeichef Sir Benjamin Thompson als Graf von Rumford in den Reichsgrafenstand zu erheben.
Nach der Französischen Revolution stießen die Franzosen 1796 unter General Jean-Victor Moreau (1763 – 1813) bis zur Isar vor und nahmen München ein (Erster Koalitionskrieg, 1792 – 1797). Sie verschonten zwar die Residenzstadt, plünderten jedoch die umliegenden Dörfer. Kurfürst Karl Theodor musste sich mit Österreich verbünden, um sie aufzuhalten. Der Hofstaat floh nach Sachsen, und Graf von Rumford, der als Vorsitzender des bayrischen Staatsrates den Kurfürsten in München vertrat, bewahrte die Stadt durch geschickte Verhandlungen mit Franzosen und Österreichern vor Kriegszerstörungen.
Im Friedensvertrag von Campoformio von 1797 trat der Habsburger Kaiser den Franzosen die österreichischen Niederlande ab.
Als Kurfürst Karl Theodor 1799 in der Münchner Residenz starb, brach die Bevölkerung in Jubel aus. Im Jahr davor hatte er sein Heer den Habsburgern unterstellen müssen, und zum Zeitpunkt seines Todes standen österreichischer Truppen mit knapp 110.000 Mann in Bayern.
München Stadtgeschichte 1799 ‒ 1825
Max Joseph: Vom Kurfürstentum zum Königreich
Weil Kurfürst Karl Theodor zwar eine Reihe unehelicher Kinder, aber keinen legitimen Erben hinterließ, kam der aus der Pfälzer Nebenlinie der Herzöge von Zweibrücken-Birkenfeld stammende Maximilian Joseph mit seiner Frau Karoline Friederike von Baden – einer Protestantin! – und den Kindern nach München, um die Nachfolge anzutreten.
Kurz nach seiner Ankunft in München ernannte Kurfürst Max IV. Joseph den Juristen und Historiker Maximilian von Montgelas zum bayrischen Außenminister, und es dauerte nicht lang, bis dieser wie ein Regierungschef amtierte. Dabei kam ihm zugute, dass er bereits vor seiner Ernennung weitreichende Reformpläne für eine Modernisierung der bayrischen Verwaltung, der Rechtspflege sowie der Finanzen und Steuern ausgearbeitet hatte. 1802 brachte Maximilian von Montgelas den Magistrat der Stadt München dazu, die Gerichts- und Polizeihoheit an den Staat abzugeben. Zwei Jahre später ersetzte ein Gremium von zwölf Magistratsräten und ebenso vielen Repräsentanten des Handwerks den Inneren und Äußeren Stadtrat.
Kurfürstin Karoline stellte an Weihnachten 1799 einen Christbaum im Schloss Nymphenburg auf ‒ und brachte so die bis dahin protestantische Tradition des Weihnachtsbaums nach München. Mit ihrer Unterstützung sorgte Maximilian von Montgelas 1802/03 für Religionsfreiheit (Toleranzedikte). Parallel dazu führte er die Säkularisation in Bayern durch. Die offiziellen Hexenverfolgungen hörten auf, die Leibeigenschaft wurde aufgehoben, und die allgemeine Schulpflicht begann. Die Regelung, der zufolge alle Christen – Katholiken, Reformierte, Lutheraner ‒ in Bayern die gleichen Bürgerrechte besaßen, wurde 1809 bestätigt (Religionsedikt). Und das Bayerische Judenedikt von 1813 bezog auch die Juden in diese Parität mit ein. Für sie galt das allerdings nur, wenn sie mit ihrem bisherigen Namen und einem neuen deutschen Familiennamen in eine limitierte Matrikel eingetragen wurden. Eine vollständige Gleichberechtigung brachte erst ein Reichsgesetz 1871.
1811 bis 1813 ließ Maximilian von Montgelas das nach ihm benannte frühklassizistische Palais am Promenadeplatz von Emanuel Josef Herigoyen errichten und von Jean Baptiste Métivier ausstatten. Davor steht eine sechs Meter hohe Statue des bayrischen Ministers. Die Berliner Bildhauerin Karin Sander ließ sie 2005 computergesteuert aus einem Aluminiumblock fräsen.
Im Juni 1800 nahm General Jean-Victor-Marie Moreau mit der Französischen Rheinarmee München ein; ein halbes Jahr besiegte er Bayern und Österreich in der Schlacht von Hohenlinden, und im Frieden von Lunéville musste Kurfürst Max Joseph auf das Herzogtum Jülich und die linksrheinischen Teile der Kurpfalz verzichten. Drei Jahre später verlor er außerdem den rechtsrheinischen Teil der Kurpfalz an Baden.
Maximilian von Montgelas sorgte dafür, dass am 25. August 1805 in seiner Sommerresidenz in Bogenhausen (heute: → Bundesfinanzhof) ein bayrisch-französischer Geheimvertrag unterzeichnet wurde und der Kurfürst die Front wechselte.
Zwei Wochen vorher waren die Österreicher erneut in Bayern einmarschiert, um ‒ gestützt auf eine Allianz mit England und Russland ‒ gegen Napoleon vorzugehen. Max Joseph floh nach Würzburg. Preußen und Russland warteten vorsichtig ab. Napoleon, dem an einem starken Bayern als Bollwerk gegen Österreich gelegen war, eilte vom spanischen Kriegsschauplatz nach Paris, stampfte ein Heer aus dem Boden, zog über den Rhein und besiegte die Österreicher bei Ulm. Statt österreichischer standen nun bis Herbst 1806 französische Truppen in München.
Im Oktober 1805 zog Napoleon durchs → Karlstor erstmals in München ein. Max Joseph traf er allerdings nicht an, denn der bayrische Kurfürst war noch in Würzburg und wagte sich erst Ende Oktober wieder in seine Residenzstadt.
Mit Wirkung vom 1. Januar 1806 wertete Napoleon das Kurfürstentum Bayern zum Königreich auf.
Noch im selben Jahr wurde der Rheinband unter französischem Protektorat gegründet (Juli), und das Heilige Römische Reich deutscher Nation löste sich auf (August). Franz von Habsburg, der 1802 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden war und sich 1804 ohne Rechtsgrundlage zum Kaiser von Österreich erklärt hatte, legte im August 1806 die bedeutungslos gewordene römische Kaiserkrone ab, amtierte allerdings bis zu seinem Tod als Kaiser von Österreich und begründete das Kaisertum Österreich als Erbmonarchie.
Im März 1807 trafen zwar die vom Goldschmied Martin Guillaume Biennais in Paris nach Entwürfen von Charles Percier angefertigten Kroninsignien in München ein, aber König Maximilian I. Joseph verzichtete bei der Inthronisierung auf eine Krönung.




Album über die Schatzkammer der Residenz
Weil der Schrannenplatz zu klein geworden war, zog 1802 ein Teil des Münchner Markts auf das Areal des 1777 aufgelassenen und 1789 eingeebneten Friedhofs von St. Peter. 1807 ordnete König Max I. Joseph an, den Markt für Agrarprodukte mit Ausnahme von Getreide auf ein Gelände zwischen der Heilig-Geist-Kirche und der Frauenstraße zu verlegen. Zu diesem Zweck riss man die bei der Säkularisierung von der Stadt erworbenen Benefizhäuser des Heilig-Geist-Spitals ab. So entstand der Marktplatz, für den später die vom lateinischen Wort »victualia« (Lebensmittel) abgeleitete Bezeichnung »Viktualienmarkt« aufkam.
Im Geist der Aufklärung wurde 1806 die Folter in Bayern abgeschafft. In München wurde 1804/05 zu letzten Mal gehenkt bzw. gerädert, und nachdem der Scharfrichter bei der Enthauptung des Sattlergesellen Christian Hussendörfer 1854 siebenmal zuschlagen musste, löste das Fallbeil das Schwert ab. Die letzte öffentliche Hinrichtung in München fand 1861 auf dem Marsfeld statt.
1808 erhielt das Königreich Bayern eine verfassungsrechtliche Grundlage und bekam die erste von den Ständen unabhängige Volksvertretung in einem deutschen Staat. Maximilian Freiherr von Montgelas, der im Jahr darauf in den Grafenstand erhoben wurde, wollte damit einer möglicherweise von Napoleon aufgezwungenen Verfassung zuvorkommen. Teil der »Revolution von oben« war das Gemeindeedikt von 1808, das die Stadt München vollends unter die Oberaufsicht des Staates stellte und bis 1818 galt.
Ebenfalls 1808 erhob König Maximilian I. die von Kurfürst Max III. Joseph gegründete Hofschule zur »Königlichen Akademie der Bildenden Künste„.
Das Lehel gilt als erste Vorstadt Münchens, hieß bis 1812 »äußeres Graggenauer Viertel« und danach »St.-Anna-Vorstadt«, aber diese Bezeichnungen setzten sich nicht durch. Friedrich Ludwig von Sckell und Karl von Fischer konzipierten 1805 bis 1810 die erste planmäßige Stadterweiterung – die allerdings erst unter König Ludwig I. realisiert und 1812 nach König Maximilian I. benannt wurde: Maxvorstadt.
Als die Österreicher 1809 erneut in Bayern einmarschierten, eilte Napoleon seinem Bündnispartner zu Hilfe und besuchte zum dritten Mal München.
Kronprinz Ludwig von Wittelsbach, der spätere König Ludwig I. von Bayern, heiratete am 12. Oktober 1810 im Alter von 24 Jahren die sechs Jahre jüngere Prinzessin Therese Charlotte Luise Friederike Amalie von Sachsen-Hildburghausen. Den Abschluss der Feierlichkeiten in München bildete am 17. Oktober ein vom Bankier Andreas Dall’Armi organisiertes Pferderennen auf einer Wiese, die damals noch außerhalb der Stadt lag und später zu Ehren der Königin den Namen »Theresienwiese« erhielt. So entstand das Münchner Oktoberfest. Zwei Tage nach der Hochzeitsfeier ernannte König Max I. Joseph seinen Sohn Ludwig zum Generalgouverneur des Gebiets östlich von Inn und Salzach, das von 1809 bis 1816 letztmalig zu Bayern gehörte. Der Kronprinz residierte abwechselnd in Salzburg und Innsbruck.
Aron Elias Seligmann (1747 – 1824) in Leimen bei Heidelberg zählte zu den bedeutendsten Finanziers deutscher Fürstenhöfe. Kurfürst Maximilian Joseph erteilte ihm 1799 das Bürgerrecht in München und sorgte dafür, dass er 1811 in die bayrische Residenzstadt umzog. Aron Elias Seligmann bewahrte den bayrischen Staat vor dem finanziellen Ruin. 1814 wurde er als Freiherr von Eichthal in den Adelsstand erhoben, und fünf Jahre später konvertierte zur römisch-katholischen Kirche.
Bei Napoleons Russlandfeldzug 1812 kommandierte General Carl Philipp Joseph von Wrede das bayrische Kontingent in der Grande Armée. Nach dem katastrophalen Ende dieses Angriffskrieges wechselte König Maximilian I. jedoch erneut die Front – wenige Tage bevor Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig (16. – 19. Oktober 1813) entscheidend besiegt wurde. 1814 musste Napoleon abdanken und auf die Insel Elba ins Exil gehen.
Auf dem Wiener Kongress 1814/15 konnte Bayern seine Souveränität und den Status als Königreich bewahren. Außerdem erhielten die Wittelsbacher das Großherzogtum Würzburg und das Fürstentum Aschaffenburg. Mit Österreich verständigte sich Bayern 1816 im Vertrag von München und verzichtete auf Salzburg, Tirol, das Inn- und das Hausruckviertel.
Etwa hundert Schaulustige starben, als der bei der Kohleninsel (heute: Museumsinsel) über die Kleine Isar führende Brückenteil am 13. September 1813 vom Hochwasser weggerissen wurde. Neugebaut wurde die später nach König Ludwig I. benannte Isarbrücke 1823 bis 1828 nach Plänen des Stadtbaurats Carl Probst und Ergänzungen von Leo von Klenze*.
Zwei Wochen nach der Erhebung Bayerns zum Königreich war Napoleon erneut nach München gekommen, um zusammen mit Kaiserin Josephine an der Trauung seines Stiefsohnes Eugène de Beauharnais mit Max Josephs Tochter Auguste Amalie in der Münchner Residenz teilzunehmen. Anschließend hatte Eugène de Beauharnais, der Vizekönig von Italien, Auguste Amalie mit nach Mailand genommen. Als das Paar nach Napoleons Scheitern Italien 1814 verlassen musste, fand es Zuflucht in München, wo König Max Joseph seinen Schwiegersohn 1817 zum Herzog von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstätt erhob. Leo von Klenze* errichtete für ihn 1817 – 1821 einen Stadtpalast (Palais Leuchtenberg, heute: Finanzministerium) an der Ludwigstraße.
*) Mehr zu Leo von Klenze im Album über Architekten

1818 ersetzte Maximilian I. die verfassungsrechtlichen Regelungen von 1808 durch eine neue Konstitution, die bis 1918 gültig blieb. In Ergänzung dazu stellte das zweite Gemeindeedikt 1818 die zehn Jahre zuvor abgeschaffte Selbstverwaltung der Gemeinden weitgehend wieder her. Die Münchner Stadtverwaltung bestand nun aus zwei Bürgermeistern, zwölf Magistratsräten und 36 Gemeindebevollmächtigen, alle aus dem obersten Drittel der Steuerzahler.
Es war eine Revolution von oben, aber der König leistete einen Eid auf die Verfassung, und Kronprinz Ludwig mahnte den Vater 1819 in einem Brief, die Verfassung einzuhalten. Bayern wurde so zur konstitutionellen Monarchie – vor den anderen Königreichen in Deutschland. Erarbeitet hatte die Verfassung Georg Friedrich von Zentner im Auftrag des Grafen von Montgelas, der jedoch auf Betreiben des Kronprinzen Ludwig 1817 entlassen worden war. Die erste bayrische Ständeversammlung trat 1819 zusammen.
König Max I. Joseph bestimmte 1818 Lothar Anselm von Gebsattel zum ersten Erzbischof des neu errichteten Erzbistums München und Freising. Allerdings musste auf die offizielle Bestätigung noch drei Jahre lang gewartet werden: 1821 nahm der Münchner Nuntius die Weihe in der Michaelskirche vor und erhob dann die Frauenkirche zum Sitz des Erzbistums.
Nach der Schließung des 1657 von Francesco Santurini am Salvatorplatz gebauten ersten öffentlichen Opernhauses in Münchens existierte 1795 nur noch das 1751 bis 1753 errichtete Residenztheater (Cuvilliés-Theater). Weil es zu klein war, gab König Maximilian I. Joseph 1810 bei Karl von Fischer* Pläne für ein neues Königliches Hof- und Nationaltheater in Auftrag, mit dessen Bau 1811 begonnen wurde. Allerdings ließen sich die ehrgeizigen Vorstellungen des Architekten aus finanziellen Gründen nur teilweise umsetzen, und 1817 brannte ein Teil des noch unfertigen Bauwerks ab. Gut vier Jahre nach der Eröffnung des Nationaltheaters am 12. Oktober 1818 zerstörte ein weiteres Feuer das Gebäude. Es heißt, zum Löschen sei im Januar 1823 Bier aus dem → Hofbräuhaus geholt worden. Leo von Klenze* leitete den Wiederaufbau und fügte die bereits von Karl von Fischer geplante, aber nicht realisierte korinthische Säulenvorhalle hinzu. Für die Innengestaltung des Zuschauerraums im späten Empirestil war der Hofdekorateur Jean Baptiste Métivier zuständig. Die Wiedereröffnung des klassizistischen Bauwerks erfolgte 1825.
Im selben Jahr starb König Maximilian I. auf Schloss Nymphenburg.
1824 hatte der Münchner Magistrat beschlossen, dem ersten bayrischen König ein Denkmal zu setzen. Der Bildhauer Christian Daniel Rauch gestaltete das klassizistische Max-Joseph-Denkmal 1826 bis 1835 in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten Leo von Klenze und dem Erzgießer Johann Baptist Stiglmaier. Die Enthüllung auf dem neuen Max-Joseph-Platz fand am 13. Oktober 1835 statt, dem zehnten Todestag des Königs Maximilian I. Joseph.
*) Mehr zu Karl von Fischer und Leo und Klenze im Album über Architekten



München Stadtgeschichte 1825 ‒ 1848
König Ludwig I.
König Ludwig I. wollte, dass München als Kunst- und Kulturmetropole (»Isar-Athen«) mit Rom und Florenz, Wien und Dresden gleichzog: »Ich werde aus München eine Stadt machen, die jeder kennen muss, der Deutschland kennen will.«
Noch als Kronprinz war Ludwig von Bayern auf dem Wiener Kongress Leopold Klenze* begegnet, der 1808 Hofarchitekt von König Jérôme Bonaparte in Kassel geworden war. Ludwig holte ihn 1815 nach München und sorgte dafür, dass Klenze 1818 auch hier zum Hofarchitekten ernannt wurde.
Leo von Klenze – 1822 geadelt – prägte das Münchner Stadtbild mit einer Vielzahl von Bauwerken, darunter: Palais Leuchtenberg (1821), Marstall (1822), Hofgartentor (1823), Wiederaufbau des Nationaltheaters (1825), Bazar-Gebäude (1826), Odeon (1828), Glyptothek (1830), Obelisk am Karolinenplatz (1833), Königsbau der Residenz (1835), Alte Pinakothek (1836), Allerheiligen-Hofkirche (1837), Monopteros (1838), Festsaalbau der Residenz (1842), Ruhmeshalle (1854), Propyläen (1860). Außerdem ließ sich Zar Nikolaus I. 1839 bis 1852 von dem deutschen Architekten die Neue Eremitage in Sankt Petersburg bauen. Neben Karl Friedrich Schinkel war Leo von Klenze der bedeutendste Vertreter des deutschen Klassizismus. Zugleich gelten Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner* ‒ der Klenze 1827 bei der Bebauung der Ludwigstraße ablöste ‒, als die beiden herausragenden Baumeister in Bayern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze im Album über Architekten
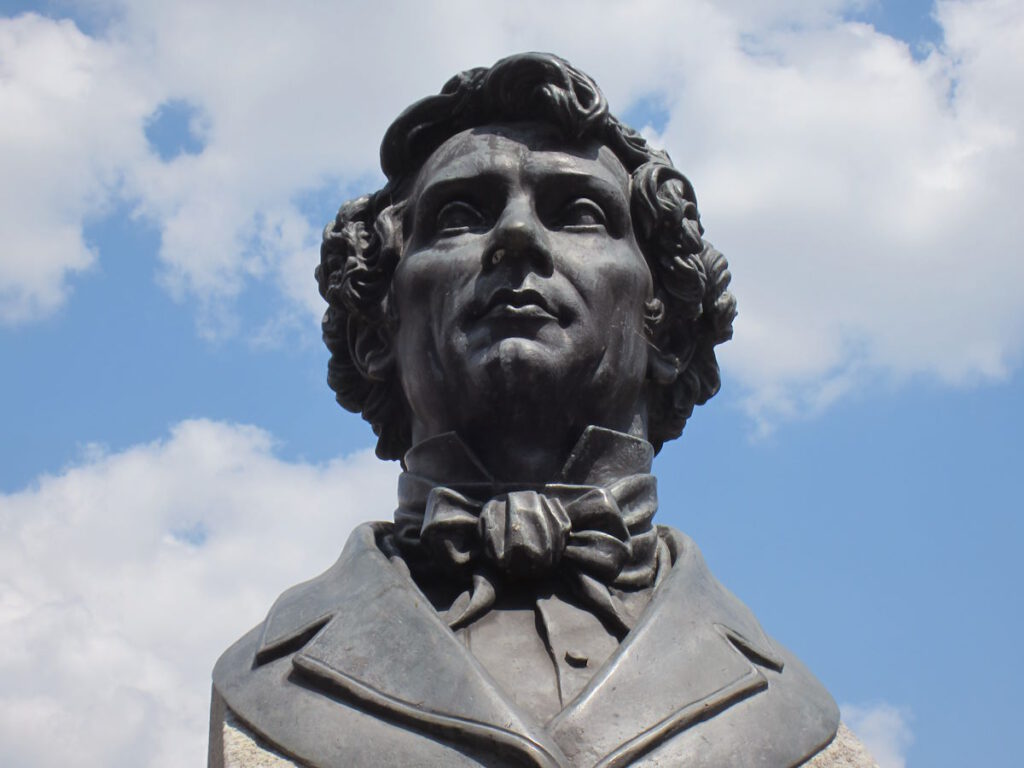





1826 bis 1835 errichtete Leo von Klenze den klassizistischen »Königsbau« der Residenz und ließ sich dabei auf Weisung des Königs von der italienischen Renaissance inspirieren. Die Hauptfassade aus Grünsandstein am → Max-Joseph-Platz erinnert an die Palazzi Pitti und Rucellai in Florenz. Während die spätklassizistischen Räume des Königs im pompejanischen Stil mit Szenen aus der Antike bemalt wurden, ließ Klenze – der nicht nur für die Architektur, sondern auch für die Ausgestaltung verantwortlich war – die der Königin mit Darstellungen von Szenen aus Werken deutschsprachiger Dichter schmücken. Die Möbel wurden 1834/35 von Münchner Tischlern und Bildhauern angefertigt.
Album übers Residenz-Museum
Für den Ausbau der Straße nach Freising hatte der Hofgartenintendant Friedrich Ludwig von Sckell* 1811 eine vierreihige Allee vorgeschlagen, aber Kronprinz Ludwig stellte sich einen Prachtboulevard vor. 1816 beauftragte er Leo von Klenze* mit der Gesamtplanung. Den löste 1827 Friedrich von Gärtner* ab, der in den klassizistischen Baustil neuromanische, neugotische und neubyzantinische Elemente einfügte. Bis 1844 entstand die Bebauung des → Odeonsplatzes und der Ludwigstraße zwischen der → Feldherrnhalle (1841 – 1844) und dem → Siegestor (1843 – 1850), beides Werke von Friedrich von Gärtner.
Ludwig ließ sowohl die Brienner- als auch die Ludwigstraße auf den Odeonsplatz zulaufen und verschob so den Mittelpunkt Münchens vom Marienplatz und Rathaus zur Residenz.
*) Mehr zu Friedrich von Gärtner, Leo von Klenze und Ludwig von Sckell im Album über Architekten


Album über die Ludwigstraße
Durch den Sturm auf die bayrischen Klöster 1802 und die im Jahr darauf sanktionierte Säkularisierung kamen rund 200.000 Handschriften und Bücher in die Münchner Hofbibliothek – darunter das »Wessobrunner Gebet« und die »Carmina burana«. Weil für die Neuzugänge nicht genügend Platz im → Antiquarium der Münchner Residenz war, wurde 1832 in der Ludwigstraße der Grundstein für die Bayerische Staatsbibliothek gelegt. Bei der Gestaltung orientierte sich Friedrich von Gärtner an Bauwerken der italienischen Frührenaissance. Bis 1842 dauerten die Arbeiten am größten Blankziegelbau Deutschlands.


Bayerische Staatsbibliothek, Statue von König Ludwig I. im Treppenhaus
Album über die Bayerische Staatsbibliothek
In seiner neuen Prachtstraße in München stellte sich König Ludwig I. als östlichen Abschluss der Schellingstraße (damals: Löwenstraße) eine von Friedrich von Gärtner gebaute Kirche vor, obwohl das Gebiet damals nur wenig bewohnt war. Das lehnte der Magistrat der verschuldeten Stadt 1828 zunächst ab, aber der König gab seine Absicht nicht auf und nach heftigen Auseinandersetzung konnte der Grundstein am 25. August 1829, dem Namenstag des Königs, gelegt werden. 1844 weihte Erzbischof Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel die Kirche St. Ludwig. An der Fassade sind Kalksteinfiguren der Evangelisten mit Christus in der Mitte zu sehen. Zwei davon und alle Entwürfe stammen von Ludwig von Schwanthaler*.
*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum

Album über die Ludwigstraße
Karl von Fischer baute mit Friedrich Ludwig von Sckell zusammen den damaligen Fürstenweg von der Münchner Residenz zum Schloss Nymphenburg für Ludwig I. zur Pracht- und Hauptachse aus, die 1826 nach der Schlacht bei Brienne benannt wurde (Brienner Straße).
Ludwig ließ sowohl die Brienner- als auch die Ludwigstraße auf den → Odeonsplatz zulaufen und verschob so den Mittelpunkt Münchens vom Marienplatz und Rathaus zur Residenz.
Bei der Gestaltung des → Königsplatzes in der Maxvorstadt ließ sich König Ludwig I. von der Begeisterung für Griechenland mitreißen.
Griechische Patrioten hatten 1814 die Geheimorganisation Filiki Eteria für den Befreiungskampf gegen die osmanische Herrschaft gegründet, und die 1821 begonnene griechische Revolution wurde von Philhellenen im Ausland unterstützt. 1822 proklamierte ein griechischer Nationalkongress die Selbstständigkeit, aber der 1827 gewählte erste griechische Staatspräsident wurde 1831 ermordet. Großbritannien, Frankreich und Russland, die 1830 die Gründung des Staates Griechenland bestätigt hatten, berieten 1832 auf der Londoner Konferenz über das weitere Vorgehen und trugen die griechische Krone dem 1815 auf Schloss Mirabell in Salzburg geborenen bayrischen Prinzen Otto von Wittelsbach an. Noch im Dezember 1832 reiste der Sohn des damaligen Kronprinzen Ludwig aus München ab, und im Januar 1833 übernahm er die Regierung in Nafplion (Nauplia).
Als Kronprinz hatte Ludwig I. 1804 mit einer Sammlung antiker Skulpturen begonnen. 1806 erwarb er beispielsweise über den Kunstagenten Johann Martin von Wagner den → Barberinischen Faun. Allerdings verweigerte der Papst den Abtransport aus Rom, und erst 1819 konnte das Kunstwerk nach München gebracht werden. Dort entstand 1816 bis 1830 nach Entwürfen von Karl von Fischer und Plänen von Leo von Klenze die Glyptothek (glyphéin = meißeln, thḗkē = Aufbewahrungsort). Reinhard Heydenreuter schreibt, es sei das erste eigenständige Museumsgebäude der Welt gewesen.
Südlich gegenüber hatte Karl von Fischer 1812 beim Entwurf des klassizistischen Königsplatzes den Kuppelbau einer Gedächtniskirche vorgesehen. Stattdessen errichtete Georg Friedrich Ziebland dort 1838 bis 1848 für König Ludwig I. ein weiteres Ausstellungsgebäude nach dem Vorbild eines korinthischen Tempels (heute: Staatlichen Antikensammlungen).
1854 bis 1862 ‒ also nach der Abdankung König Ludwigs I. ‒ schloss Leo von Klenze den Königsplatz mit den Propyläen ab. Dabei orientierte er sich an der Akropolis in Athen.


Die Anfänge der Alten Pinakothek im Kunstareal gehen auf Historienbilder zurück, die Herzog Wilhelm IV. ab 1528 in Auftrag gegeben hatte, darunter die »Alexanderschlacht« von Albrecht Altdorfer. Kurfürst Maximilian I. ließ sich 1627 von Nürnberg »Die vier Apostel« von Albrecht Dürer übergeben. Kurfürst Max Joseph, der spätere König Maximilian I., ernannte 1799 den Maler und Architekten Johann Christian von Mannlich zum pfalz-bayrischen Zentraldirektor aller Kunstsammlungen, und die von Mannlich 1793 vor den französischen Revolutionstruppen in Pfalz-Zweibrücken gerettete Gemäldesammlung bildete einige Jahrzehnte später den Grundstock eines Museums in München, das Leo von Klenze 1826 bis 1836 für König Ludwig I. baute. Die Alte Pinakothek – so der Name seit 1853 – gilt als eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt.
Alte Pinakothek
Nach Entwürfen seines Lehrers Friedrich von Gärtners* errichtete August von Voit* die Neue Pinakothek, die am 25. Oktober 1853 als Pendant zur (Alten) Pinakothek eröffnet wurde und die erste Galerie »moderner« Kunst weltweit war.
Alben über die Pinakotheken und das Kunstareal
1826 holte König Ludwig I. die 1472 in Ingolstadt gegründete und 1800 nach Landshut verlegte Universität nach München und beauftragte im Jahr darauf Friedrich von Gärtner, einen Entwurf für ein Universitätsgebäude an der Ludwigstraße vorzulegen. Die Bauarbeiten dauerten von 1835 bis 1840. Bis zur Fertigstellung des Neubaus nutzte die Ludwig-Maximilians-Universität Räume der → Alten Akademie.
»Ludwig-Maximilians-Universität«, der 1802 eingeführte Name (»Ludovico-Maximilianea«) verweist nicht auf König Ludwig I., der die Hochschule nach München brachte, sondern auf den Gründer Herzog Ludwig IX. den Reichen und auf Max Joseph, der die Universität 1800 von Ingolstadt nach Landshut umgesiedelt hatte.
*) Mehr zu Friedrich von Gärtner und August von Voit im Album über Architekten


1840 bis 1844 schuf Friedrich von Gärtner vor dem Universitätsgebäude zwei baugleiche Schalenbrunnen nach römischem Vorbild.


Alben über die Ludwigstraße und die Universitäten
Anlässlich seiner Silberhochzeit mit Therese von Sachsen legte König Ludwig 1835 den Grundstein für St. Bonifaz. Die Kirche der Benediktinerabtei sollte ihre Grablege werden. Gebaut wurde die Klosteranlage nach Entwürfen des Architekten Georg Friedrich Ziebland*, der sich bei der Kirche von altchristlichen Basiliken in Rom und Ravenna inspirieren ließ. Das Portal gestaltete Leo von Klenze* nach dem Vorbild der Kathedrale St. Dionysius Areopagita in Athen.
*) Mehr zu Leo von Klenze und Georg Friedrich Ziebland im Album über Architekten


Album über St. Bonifaz
Leo von Klenze hatte 1824 angefangen, sich mit Entwürfen eines kolossalen Standbildes der Bavaria zu beschäftigen, einer Allegorie für Bayern. Dabei ging er von griechischen Vorbildern aus. 1837 beauftragte König Ludwig I. ihn, den Bildhauer Ludwig Schwanthaler* und den Erzgießer Johann Baptist Stiglmaier mit der Realisierung des Vorhabens. Ludwig Schwanthaler wich bei seinen Entwürfen bald von Leo von Klenzes Vorstellungen ab: die Bavaria sollte mehr germanisch als griechisch aussehen. Sechs Jahre lang arbeitete er an einem Gipsmodell in Originalgröße. Kurz bevor die Vorbereitungen für den Guss abgeschlossen waren, starb Johann Baptist Stiglmaier am 2. März 1844, und sein Neffe Ferdinand von Miller führte die Arbeiten zu Ende.
Noch im selben Jahr wurde der Kopf der Bavaria gegossen. Die weiteren Einzelteile – Arme, Brust, Hüfte, Unterteil, Löwe – entstanden bis Dezember 1849. Bei der 18,52 Meter hohen Bronzefigur handelt es sich um die erste seit der Antike in Bronze gegossene Kolossalstatue überhaupt. Eine technische Meisterleistung. Die Einzelteile wurden im Sommer 1850 zur Theresienhöhe am Westrand der Ludwigsvorstadt transportiert und auf einem knapp neun Meter hohen Steinsockel aufgebaut. Die Enthüllung fand am 9. Oktober 1850 während des Oktoberfestes statt.
*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler im Album über Kunst im öffentlichen Raum



König Ludwig I. förderte nicht nur Kunst und Wissenschaft, sondern auch den technischen Fortschritt. 1834 hatte die »Königlich privilegierte Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft« die staatliche Konzession zum Bau einer Eisenbahnstrecke zwischen Nürnberg und Fürth erhalten. Am 7. Dezember 1835 war dort die erste mit Lokomotiven betriebene Eisenbahn in Deutschland (»Ludwigseisenbahn«) gefahren.
Der Glockengießersohn Peter Paul Maffei (1754 – 1836) zog als Jugendlicher von Trient nach München und übernahm später von seinem Schwiegervater eine Tabakfabrik. Sein Sohn Anton Ritter von Maffei (1790 – 1870) erwarb 1837 ein Eisenwerk am Eisbach in der Hirschau, gründete den ersten Industriebetrieb in München und baute Lokomotiven. Bis 1864 lieferte er 500 Lokomotiven aus. Zwei Jahre später (1866) gründete der Webersohn Georg Krauss (1826 – 1906, 1905 geadelt) auf dem Marsfeld am Bahngelände eine zweite Lokomotivenfabrik in München. (1931 fusionierten die beiden Konkurrenten zur Krauss-Maffei AG.) Für die Eisenbahn arbeitete auch die vom Huf- und Wagenschmied Joseph Rathgeber 1851/52 in der Marsstraße gegründete Waggonfabrik, die sich bis 1900 zum größten Arbeitgeber in München entwickelte und 1911 nach Moosach umzog, in einen ab 1908 errichteten Neubau (heute: → »Meiller Gärten«).
Ebenfalls mit privaten Mitteln wurde die Bahnstrecke München – Augsburg angelegt. Dafür baute die München-Augsburger Eisenbahn-Gesellschaft auch einen Münchner Bahnhof aus Holz auf dem Marsfeld (auf Höhe der heutigen → Hackerbrücke), der bei der Eröffnung des ersten Streckenabschnitts München – Lochhausen 1839 in Betrieb genommen wurde, ein Jahr vor der Fertigstellung der gesamten Strecke. Weil sich die Münchner über die Entfernung zum Bahnhof beklagten, beauftragte der König seinen Baumeister Friedrich von Gärtner* 1843 mit der Planung eines neuen Bahnhof näher am damaligen Stadtrand (Karlstor). Die Realisierung zog sich hin – bis das hölzerne Bahnhofsgebäude im April 1847 abbrannte. Der »Centralbahnhof« wurde nun auf das Gelände der → »Schießstätte der königlich privilegierten Hauptschützengesellschaft München von 1406« verlegt, an den Ort des heutigen Hauptbahnhofs, und der von Gärtners Schüler Friedrich Bürklein* ausgeführte Neubau konnte ab 1849 genutzt werden. (1876 bis 1884 erfolgte ein Umbau.) Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs holten die größeren Hotels ihre Gäste von dort ab bzw. brachten sie dorthin zurück, zunächst mit Droschken, ab 1900 mit motorisierten Fahrzeugen. Eine Konzession für eine Pferdeomnibuslinie zwischen Bahnhof, Marienplatz und Au erhielt 1861 der Münchner Kutscher Michael Zechmeister.
König Ludwig I. wollte Bauern, Handwerker und Händler darüber hinaus durch Kredite fördern. Damit jedoch ein Bauer einen Hof kaufen oder ein Handwerker eine Manufaktur gründen konnte, benötigte er ein Startkapital, und in noch größerem Maße wollte der Staat zum Beispiel in die Eisenbahn investieren. Die Entwicklung Bayerns vom Agrar- zum Industriestaat wäre ohne Großinvestitionen gar nicht möglich gewesen. In dieser Lage fand im Dezember 1830 die erste Sitzung der Münchner Börse statt. Außerdem beschloss der bayrische Landtag 1834 die »Errichtung einer Hypotheken- und Wechselbank«, die im Jahr darauf ihr Geschäft in München eröffnete. Als Gründungsdirektor dieser ersten Großbank in Deutschland auf Aktienbasis amtierte Simon Freiherr von Eichthal. Die Bank gab nicht nur Hypotheken aus, sondern sammelte auch Geld von Sparern ein, das sie als Kredite vergeben konnte. Außerdem besaß die Hypotheken- und Wechselbank in München von 1836 bis zur Ausgliederung einer reinen bayrischen Notenbank im Jahr 1875 das Banknotenprivileg für Bayern. Bis der Neubau in der heutigen Kardinal-Faulhaber-Straße bezugsfertig war (1898), arbeitete die Bank im 1723 bis 1728 von Joseph Effner* für den Oberstjägermeister Johann Maximilian IV. Emanuel Graf von Preysing-Hohenaschau errichteten Stadtpalast (→ Preysing-Palais).
Bis 1875 wurde ein Dutzend Banken in München gegründet, und 1876 eröffnete auch die Reichsbank eine Niederlassung in München. Damit überflügelte München die alten bayrischen Banken-Standorte Augsburg und Nürnberg. Carl von Thieme gründete 1880 die »Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft« in München, die inzwischen zum wichtigsten Rückversicherer der Welt geworden ist.
*) Mehr zu Friedrich Bürklein, Joseph Effner und Friedrich von Gärtner im Album über Architekten
Ehemalige Bayerische Hypotheken u Wechselbank, Kardinal-Faulhaber-Straße 10 (Fotos: Juni 2024 / Februar 2026)
Album über Palais
Nach der Julirevolution (1830) in Paris änderte König Ludwig I. seine politische Einstellung: War er bei seinem Regierungsantritt noch als liberaler Hoffnungsträger begrüßt worden, kehrte er nun zu einer absolutistischen Haltung zurück, begann seine Minister als Erfüllungsgehilfen zu behandeln und führte an der zuständigen Ständekammer vorbei die Zensur wieder ein. Obwohl seine Mutter, seine Schwester und seine Frau Protestantinnen waren, förderte er den politischen Katholizismus ‒ nicht aus Überzeugung, sondern aus Staatsräson. Ludwig I. lehnte die Säkularisation ebenso ab wie die von Maximilian Graf von Montgelas eingeleiteten Reformen. 1842 begab er sich zur Eröffnung des Landtags nicht mehr in die Prannerstraße, sondern beorderte das Parlament in den Festsaalbau der Residenz.
1578 hatte man in Bayern »leichtfertige« Eheschließungen verboten. Ab 1818 waren die Gemeinden in Bayern für die Erteilung einer Heiratsgenehmigung zuständig, und 1825 wurde eine liberalere Regelung eingeführt, denn in München kamen auf 1227 eheliche 1028 uneheliche Geburten (1826/27). Aber schon 1834 wurden die Bestimmungen wieder verschärft: Nun gab es die Heiratsgenehmigung ab einem Mindestbetrag gezahlter Steuer.
Zu diesem Zeitpunkt wurde der einzelne Mensch noch an einem konkreten Ort in einer bestimmten Gesellschaftsgruppe geboren, und an seiner Zugehörigkeit änderte sich zeitlebens nichts, obwohl Bauern in Bayern ab 1808 schrittweise von der grundherrschaftlichen Abhängigkeit und Gerichtsbarkeit befreit wurden (»Bauernbefreiung«).
Als eine Cholera-Epidemie Bayern erfasste, zog sich der Hofstaat nach Berchtesgaden zurück, während die Seuche von Oktober 1836 bis Januar 1837 die Münchner Bevölkerung dezimierte.
Während sich Königin Therese um die Familie kümmerte, amüsierte sich König Ludwig mit anderen Frauen. Auf einer Italienreise hatte sich Ludwig Anfang 1821 in die verheiratete Marianna Marchesa Florenzi (1802 – 1870) verliebt. Die Liaison hielt jahrzehntelang; die beiden besuchten sich gegenseitig und schrieben sich tausende von Briefen. 1828 porträtierte der Hofmaler Joseph Karl Stieler die Italienerin für die 1827 bis 1850 im Auftrag des Königs angefertigte Galerie von 36 Schönheiten. (Nach Stielers Tod fügte dessen Schüler Friedrich Dürck noch zwei hinzu.) Eines der Gemälde im Schloss Nymphenburg zeigt Lola Montez.

Die Tänzerin, die sich als Spanierin ausgab, kam im Oktober 1846 nach München. Der König empfing sie drei Tage nach ihrer Ankunft und besuchte sie dann bis zu zweimal im Hotel Bayerischer Hof. Er zahlte ihr heimlich eine Pension in Höhe von zehn Professorengehältern, überhäufte sie mit Geschenken, schrieb ihr Briefe und Gedichte. Um sie gesellschaftsfähig zu machen, erwarb er für sie ein Palais in der Maxvorstadt und erhob sie gegen den erklärten Willen des bayrischen Staatsrats zur Gräfin von Landsfeld. Als sich die Proteste 1847 steigerten, ließ König Ludwig I. im Februar 1848 die → Ludwig-Maximilians-Universität schließen. Diese Anordnung musste er nach wenigen Tagen zurücknehmen, und der Innenminister Franz von Berks sorgte dafür, dass Lola Montez nach Lindau gebracht wurde. Am 24. Februar 1848 überquerte sie die Grenze zur Schweiz.
In der brodelnden Atmosphäre stürmten Demonstranten am 6. März das Zeughaus in München und zogen mit den erbeuteten Waffen zur Residenz. Dem König blieb nichts anderes übrig, als den Liberalen in der sogenannten Märzproklamation erhebliche Zugeständnisse zu machen. Am 20. März 1848 dankte er deshalb zugunsten seines Sohnes Maximilian II. Joseph ab und zog sich ins Wittelsbacher Palais zurück. »Regieren konnte ich nicht mehr und einen Unterschreiber abgeben wollte ich nicht«, erklärte er seinem Kunstagenten Martin von Wagner.
Im Auftrag der Stadt formte der Bildhauer Max von Widnmann* das Reiterdenkmal König Ludwigs I. am → Odeonsplatz nach einem Entwurf seines Kollegen Ludwig von Schwanthaler*, und in Bronze gegossen wurde es in Ferdinand von Millers Werkstatt. Man enthüllte das Monument am 25. August 1862, dem 76. Geburtstag des abgedankten Monarchen, der nicht an der Feier teilnahm.
*) Mehr zu Ludwig von Schwanthaler und Max von Widnmann im Album über Kunst im öffentlichen Raum


München Stadtgeschichte 1848 ‒ 1875
König Maximilian II.
König Maximilian II. Joseph berief nach seiner Inthronisation (1848) einen Reformlandtag ein und regierte als konstitutioneller Monarch.
Zu dieser Zeit überschritt die Zahl der Einwohner Münchens die 100.000-Marke. Und die Stadt wuchs rasch weiter: 1854 wurden sowohl die Stadt Au als auch Giesing und Haidhausen eingemeindet. 1875 wohnten bereits 200.000 Menschen in München.
Ab 1851 ließ König Maximilian II. eine dritte Prachtstraße anlegen: die Maximilianstraße. Dabei war der Architekt und königliche Baurat Friedrich Bürklein* für die Bebauung verantwortlich, der Ingenieur Arnold von Zenetti* leitete den Straßenbau, und dem Hofgärtner Carl von Effner** ‒ einem Urenkel des Baumeisters Joseph Effner* ‒ oblag die Bepflanzung. Bemerkenswert ist, dass dabei auch wieder Grünanlagen entstanden, während König Ludwig I. bei der Stadtplanung nur an Gebäude, Straßen und unbegrünte Plätze gedacht hatte.
Im Zuge der Bebauung errichtete Friedrich Bürklein 1856 bis 1864 ein neues Gebäude für die Königliche Regierung von Oberbayern mit einer 170 Meter langen, mit Terrakotta verkleideten Schaufront im »Maximilianstil«. Diesen an der Neugotik orientierten historisierenden Stil hatte Frierich Bürklein 1853 beim Entwurf der → »Frauengebäranstalt« in der Sonnenstraße entwickelt. Der Bildhauer Johann von Halbig*** schuf 1864 die drei weiblichen Statuen auf dem Dach des Gebäudes in der Maximilianstraße. Sie sollen die Tugenden des Königs Maximilian II. darstellen: Fides, Justitia und Sapientia.
*) Mehr zu Friedrich Bürklein, Joseph Effner und Arnold von Zenetti im Album über Architekten
**) Mehr zu Carl von Effner im Album über Denkmäler
***) Mehr zu Johann von Halbig im Album über Kunst im öffentlichen Raum

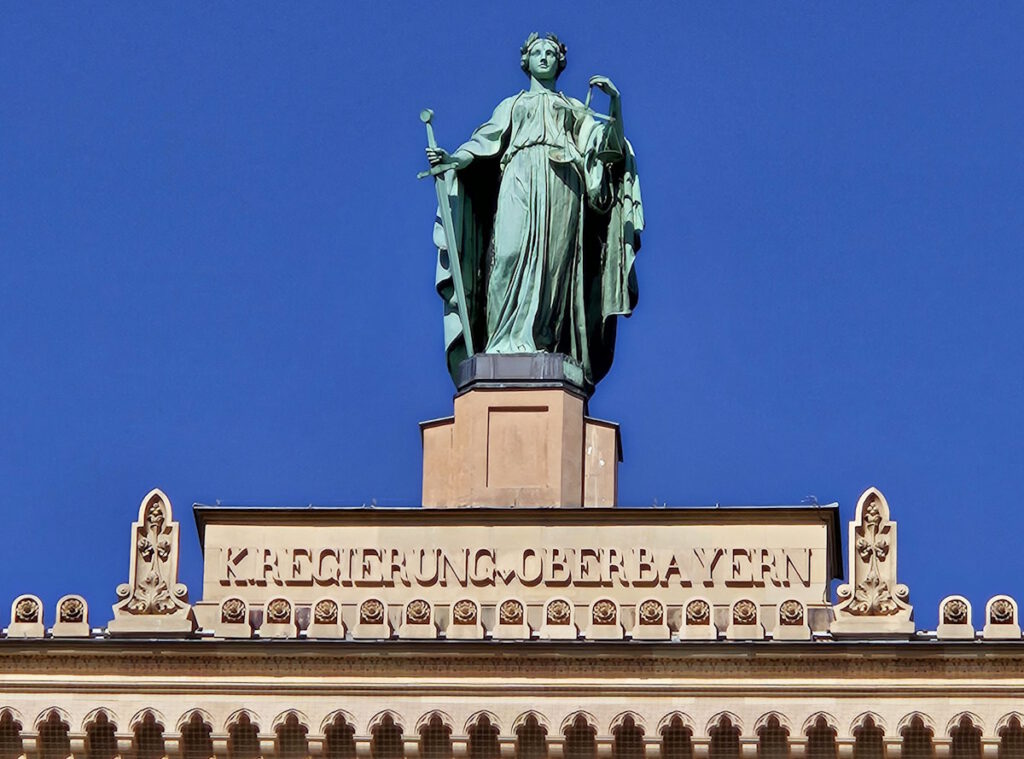



Gegenüber baute Eduard Riedel 1859 bis 1865 ein Gebäude für das Bayerische Nationalmuseum. (Das zog 1900 in die Prinzregentenstraße um, und 1925/26 richtete sich das Museum für Völkerkunde ‒ heute: Museum fünf Kontinente ‒ in dem Bauwerk an der Maximilianstraße ein.)
Die Brücke, auf der die Maximilianstraße die Isar überquert, entstand 1857 bis 1863 nach Plänen von Arnold von Zenetti.
1857 wurde der Grundstein für das Maximilianeum in Haidhausen gelegt. Friedrich Bürklein konzipierte als Abschluss der Maximilianstraße eine Kulissenarchitektur am Hochufer der Isar im Maximilianstil. Die Bauarbeiten dauerten bis 1874, und viel Kritik zwang Friedrich Bürklein zu ungewollten Planänderungen. Das machte ihn krank.

Maximilian II., dem Michael Schattenhofer einen »enzyklopädischen Wissensdrang« attestiert, beschränkte sich bei der Förderung der Wissenschaften nicht auf bayrische Persönlichkeiten, sondern warb zum Missfallen der Münchner auch »Nordlichter« an. (Diesen Begriff prägte Ernst Zander 1855 im »Volksboten für den Bürger und Landmann«.)
Ende 1851 folgte der Lübecker Dichter Emanuel Geibel (1815 – 1884) einem gut dotierten Angebot des bayrischen Königs und zog nach München. Auf seine Empfehlung hin holte Maximilian II. 1854 auch den Berliner Schriftsteller Paul Heyse (1830 – 1914) in die Isarmetrople, wo der »Dichterfürst« neben anderen Mitgliedern der intellektuellen Elite an den Abendsymposien des Monarchen in der Residenz teilnahm und 1856 selbst den Dichterkreis »Die Krokodile« gründete, der bis 1882 existierte.
König Maximilian II. persönlich lud auch Justus von Liebig* (1803 – 1873) nach München ein, und 1852 nahm der in Gießen berühmt gewordene Chemiker die Berufung zum Professor der Ludwig-Maximilians-Universität an. An der Sophienstraße ließ ihm der Monarch eine Wohnung mit Labor einrichten.
*) Mehr über Justus von Liebig im Album über Denkmäler

Auf Anregung des Historikers Leopold von Ranke (1795 – 1886, 1865 geadelt) gründete König Maximilian II. 1858 die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, eine Mischung als Gelehrtengesellschaft und Forschungseinrichtung, die bis heute wichtige Quelleneditionen und Biografien erarbeitet.
1851 bis 1853 errichtete der Architekt Franz Karl Muffat (1797 – 1868) die zunächst an allen Seiten offene mehr als 400 Meter lange → Schrannenhalle (Maximilians-Getreide-Halle), damit der Getreidemarkt vom heutigen Marienplatz (damals: Schrannenplatz) dorthin verlegt werden konnte. Es handelte sich um das erste Eisenbauwerk in München und gilt als technische Meisterleistung.

Eine Steigerung erfolgte 1853/54, als in Bahnhofsnähe – auf dem Areal, auf dem sich heute der → Alte Botanische Garten befindet – ein 234 Meter langer, 67 Meter und 25 Meter hoher Glaspalast nach Plänen des Architekten August von Voit* für die Erste Allgemeine Deutsche Industrieausstellung entstand.
Allerdings brach im September 1854 erneut die Cholera in München aus, und auch rasch abreisende Ausstellungsgäste blieben von der Erkrankung nicht verschont. Unter den 3000 Toten befand sich Königin Therese, die Mutter des regierenden Monarchen Maximilian II.
Die Münchner Weißwurst wurde einer Legende zufolge am 22. Februar 1857 im Gasthaus »Zum Ewigen Licht« am Marienplatz vom 36-jährigen Wirtsmetzger Joseph Moser (Moser Sepp) durch Zufall erfunden. Als ihm nämlich die Saitlinge für seine Kalbsbratwürstel ausgingen, füllte er das Brät in Schweinedärme und brühte die Würste wie Bratwürstel in heißem Wasser, verzichtete aber auf das Braten, weil er befürchtete, dass sie dabei platzen würden. Der Münchner Stadtarchivar Richard Bauer glaubt allerdings, dass es die Münchner Weißwurst nicht erst seit 1857 gibt: Er nimmt an, dass es sich bei der Weißwurst um eine Weiterentwicklung der sehr viel älteren Maibockwurst handelt.
*) Mehr zu August von Voit im Album über Architekten

Album zur Münchner Weißwurst
Karl Freiherr von Eichthal (Geburtsname: Carl Seligmann, 1813 – 1880) war mit Isabella Gräfin Khuen von Belasi verheiratet, der Miteigentümerin einer Waffenfabrik im säkularisierten Kloster St. Blasien. 1856 gehörte er zu den Gründern der königlich privilegierten Actiengesellschaft der bayerischen Ostbahnen. Der Hofbankier erwarb außer zwei Schlössern (Hohenburg, Egg) viel Land. 1861, als die Isarvorstadt noch großenteils aus Wiesen bestand, legte Karl Freiherr von Eichthal einen Bebauungsplan für seinen »Eichthal-Anger« vor und begann, ein erstes größeres Mietshausviertel in München für den ärmeren Teil der Bevölkerung zu errichten: das Gärtnerplatzviertel. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) ließ er das → Franzosenviertel in Haidhausen folgen.
König Max II. starb 1864 – vier Jahre vor seinem Vater Ludwig I.
Auf halber Höhe zwischen der Residenz und dem → Maximilianeum ließ Friedrich Bürklein 1875 zu Ehren des verstorbenen Königs ein Denkmal in der Maximilianstraße aufstellen: das → »Maxmonument«. Ferdinand von Miller übernahm den Bronzeguss. Enthüllt wurde das Max-II-Denkmal am 12. Oktober 1875 auf einem Sockel aus Meißner Granit. Die vier unter der Statue des Monarchen sitzenden Figuren symbolisieren Herrschertugenden: Friedensliebe, Gerechtigkeit, Stärke und Weisheit.



München Stadtgeschichte 1864 ‒ 1886
Ludwig II., der Märchenkönig
Ludwig, der älteste Sohn, folgte dem Vater auf den Thron. Der 18-Jährige wollte das Rad der Geschichte wieder zurückdrehen, zur absolutistischen Monarchie, denn er träumte zunächst davon, die Sonne des Staates Bayern zu sein.
Einige Wochen nach seiner Thronbesteigung lud König Ludwig II. den Komponisten Richard Wagner nach München ein und empfing ihn Anfang Mai in der Residenz. Der Künstler konnte sein Glück kaum fassen, denn sein Bewunderer stellte ihm nicht nur finanzielle Mittel zur Tilgung seiner Schulden zur Verfügung, sondern überließ ihm auch ein Haus in der Brienner Straße und finanzierte fortan seine Musikprojekte. So fand am 10. Juni 1865 die Uraufführung des Musikdramas »Tristan und Isolde« am Königlichen Hof- und Nationaltheater München statt.

das am 21. Mai 1913 – einen Tag vor dem 100. Geburtstag des Komponisten –
in der Nähe des Prinzregententheaters in Bogenhausen enthüllt wurde.
Rasch steigerte sich die Kritik sowohl königlicher Familienmitglieder, als auch der Regierung und der Bevölkerung an Richard Wagner, der immer anspruchsvollere Forderungen stellte. Skandalös war auch seine Beziehung mit der unehelichen Liszt-Tochter Cosima, die (noch bis 1870) mit dem Dirigenten Hans von Bülow verheiratet war und am 10. April 1865 in München die von Richard Wagner gezeugte Tochter Isolde gebar. Im Dezember 1865 musste der Komponist München verlassen.
Aber Ludwig II. besuchte ihn 1866 in dem Landhaus bei Luzern, für das er die Miete bezahlte und spielte mit dem Gedanken, als König abzudanken. Das konnte man ihm ausreden: Er kehrte nach München zurück – und förderte Richard Wagner auch weiterhin. So fand 1868 auch die Uraufführung der Oper »Die Meistersinger von Nürnberg« in München statt.
Mit dem Bau eines Wagner-Festspielhauses am Hochufer der Isar (in den Maximiliansanlagen, wo sich heute das → Denkmal für König Ludwig II. befindet) und einer neuen Prachtstraße als Zufahrt beauftragte der Monarch den Architekten Gottfried Semper. Aber die hochfliegenden Pläne scheiterten 1868 am Widerstand sowohl aus der königlichen Familie, als auch der Regierung und der Bevölkerung. Statt einer Verlängerung der Brienner Straße nach Osten entstand Ende des 19. Jahrhunderts die am → Prinz-Carl-Palais beginnende Prinzregentenstraße mit der → Luitpold-Brücke.
Denkmal für König Ludwig II. in den Maximiliansanlagen
Der für Richard Wagners Musik schwärmende König hielt sich allerdings nicht an die Vorstellungen des Komponisten und veranlasste die Uraufführung der Oper »Das Rheingold« 1869 im Münchner Nationaltheater, obwohl Richard Wagner damit bis zur Fertigstellung der Tetralogie »Der Ring der Nibelungen« warten wollte. Der Komponist reiste deshalb auch nicht an. Zur Uraufführung der Oper »Die Walküre« im Jahr darauf lud ihn der König gar nicht erst ein.
Statt in München wurde das Richard-Wagner-Festspielhaus 1872 bis 1876 auf dem Grünen Hügel in Bayreuth gebaut, von Otto Brückwald nach Entwürfen Richard Wagners im Stil der hellenistischen Romantik.
Bemerkenswert ist, dass sich Ludwig II. von Richard Wagners Antisemitismus distanzierte und beispielsweise das Münchner Hofopernorchester für die Uraufführung des Bühnenweihfestspiels »Parsifal« 1882 nur unter der Bedingung nach Bayreuth reisen ließ, dass der aus einer Rabbinerfamilie stammende Dirigent Hermann Levi die musikalische Leitung übernehmen konnte.
Der Architekt August von Voit* hatte bereits 1851 bis 1854 für König Maximilian II. einen Wintergarten nach einem Entwurf von Franz Jakob Kreuter neben dem → Königsbau der Residenz anlegen lassen. König Ludwig II. ließ 1869/70 von August von Voit auf dem Festsaalbau der Münchner Residenz einen 70 Meter langen und 10 Meter hohen Wintergarten errichten, vom Hofgärtendirektor Carl von Effner* einen exotischen Landschaftsgarten mit See anlegen, und der Theatermaler Christian Jank dekorierte dieses extravagante »Paradies«.
1868 gründete König Ludwig II. eine polytechnische Schule in München, die 1877 offiziell die Bezeichnung Königlich Bayerische Technische Hochschule München erhielt (heute: → Technische Universität München). 1864 bis 1868 war das entsprechende Gebäude im Stil der Neurenaissance nach Plänen des Architekten Gottfried von Neureuther an der Arcisstraße entstanden. Derselbe Architekt gestaltete 1876 bis 1886 auch den Neubau für die Königlich-Bayerische Akademie der Bildenden Künste in München.
*) Mehr zu Carl von Effner und August von Voit im Album über Architekten




Album über die Akademie der Bildenden Künste München
1861 nahm der Lohnkutscher Michael Zechmeister den Betrieb eines fahrplanmäßigen Stellwagenverkehrs zwischen dem Centralbahnhof und dem → Mariahilfplatz in der Au auf. Weil die Armen sich die Fahrt mit dem »Groschenwagen« nicht leisten konnten und die Reichen Kutschen bevorzugten, blieb die erhoffte Nachfrage zwar aus, aber Michael Zechmeister begann dennoch 1869 mit dem Betrieb eines von Pferden gezogenen Stadtbusses. Und 1876 fuhr die erste Pferde-Trambahn in München auf Schienen zwischen dem → Promenadeplatz und Nymphenburg. Dafür hatte der belgische Unternehmer Édouard Otlet (1842 – 1907) eine Konzession bekommen. (Mehr dazu: Geschichte des ÖPNV)
Die bayerische Gemeindeordnung von 1869 brachte den Kommunen die Selbstverwaltung einschließlich der polizeilichen Befugnisse zurück. In München hatten nun zwei Juristen als Bürgermeister, 20 Magistratsmitglieder und ein 60-köpfiges Kollegium von Gemeindebevollmächtigten das Sagen.
Noch als Kronprinz hatte Ludwig 1863 bei einem Essen im Schloss Nymphenburg neben Otto von Bismarck gesessen, den der preußische König Wilhelm I. im Jahr davor zum Ministerpräsidenten und Außenminister ernannt hatte. Der preußische Regierungschef betrieb inzwischen eine Politik, die auf ein von Preußen dominiertes Deutsches Reich ohne Österreich abzielte. Damit war die von Ludwigs Vater Maximilian II. und von der Regierung auch unter seinem Nachfolger verfolgte »Trias-Idee« nicht in Einklang zu bringen: ein Zusammenschluss süddeutscher Klein- und Mittelstaaten unter bayrischer Führung, also die Schaffung einer dritten Macht zwischen Preußen und Österreich.

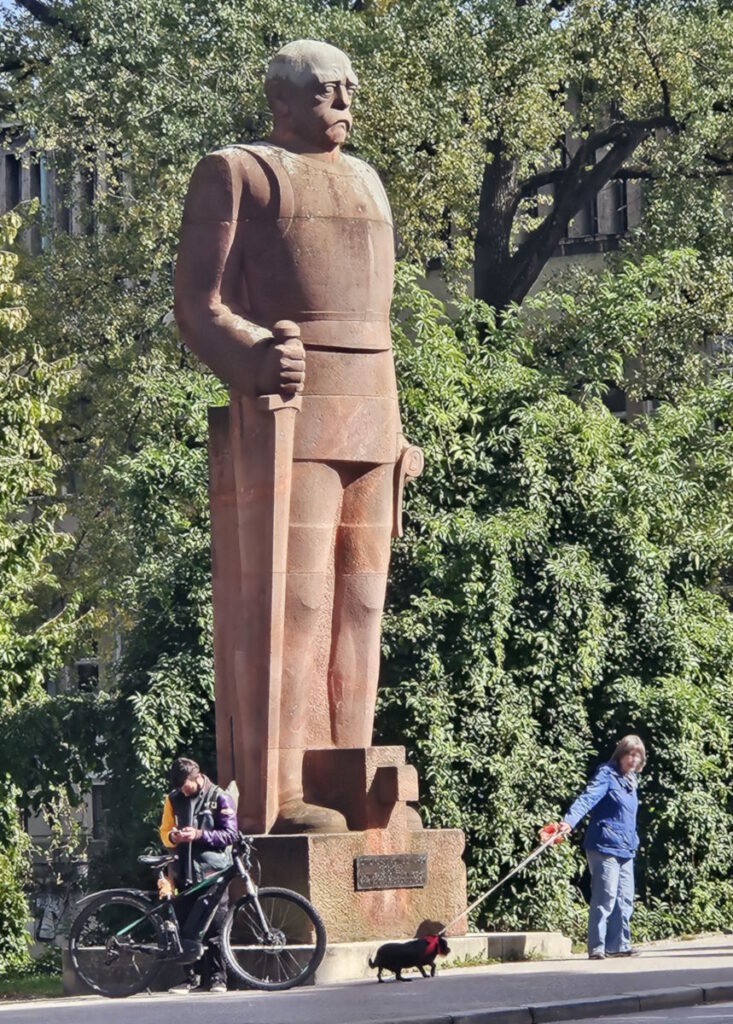

1866 kam es zum Krieg. Den entschied Preußen noch im selben Jahr mit dem Sieg über Österreich in der Schlacht von Königsgrätz für sich. Bayern stand mit Österreich auf der Verliererseite. Ludwig Freiherr von der Pfordten, der Vorsitzende des bayrischen Ministerrats, erreichte dennoch durch geschickte Verhandlungen mit Otto von Bismarck, dass Bayern zwar eine Kriegsentschädigung zahlen und sein Heer im Kriegsfalle preußischem Oberbefehl unterstellen musste, aber zumindest formal souverän blieb.
1870 provozierte Bismarck die Franzosen zur Kriegserklärung. König Ludwig II. musste in München die Mobilmachung unterzeichnen und die bayrische Armee im Norddeutschen Bund gegen Frankreich kämpfen.
Während man in München nach dem Scheitern der Trias-Idee auf eine großdeutsche Lösung im Einklang mit Österreich und unter einem Habsburger als Kaiser hoffte, wollte Bismarck den preußischen König Wilhelm I. zum Kaiser eines Reichs ohne Österreich ausrufen. Weil der jedoch zögerte, sich darauf einzulassen, bestach Bismarck den Wittelsbacher in München mit etwa sechs Millionen Goldmark aus dem beschlagnahmten Vermögen des 1866 annektierten Königreichs Hannover (Welfenfonds). Ludwig unterzeichnete erwartungsgemäß einen vorformulierten Brief, in dem es hieß: »Ich habe mich […] an die deutschen Fürsten mit dem Vorschlage gewendet, gemeinschaftlich mit mir bei Ew. Majestät in Anregung zu bringen, daß die Ausübung der Präsidialrechte des Bundes mit Führung des Titels eines deutschen Kaisers verbunden werde.« Ludwigs Onkel, Prinz Luitpold von Bayern, übergab Wilhelm I. den »Kaiserbrief« am 3. Dezember 1870, und zwei Wochen später akzeptierte der preußische König die Krone ‒ ohne etwas von der Schmiergeldzahlung in Ludwigs Privatschatulle zu ahnen. Am 18. Januar 1871 proklamierten die deutsche Fürsten den preußischen König zum Kaiser des Deutschen Reiches ‒ und zwar im Spiegelsaal von Versailles, um die im Deutsch-Französischen Krieg unterlegenen Franzosen zu demütigen. Ludwig II. reiste allerdings nicht an, sondern ließ sich durch seinen Onkel Luitpold und seinen Bruder Otto vertreten.
Das Deutsche Kaiserreich war am 1. Januar 1871 durch den Beitritt der Territorien Hessen, Baden und Württemberg zum Norddeutschen Bund entstanden. In München nahm der Landtag erst am 21. Januar den Beitrittsvertrag an, aber er trat rückwirkend zum Jahresanfang in Kraft, als ihn König Ludwig II. unterzeichnete.
Der Deutsch-Französische Krieg endete am 10. Mai 1871 mit dem Friedensvertrag von Frankfurt am Main.
Ludwig I. und Maximilian II. prägten das Stadtbild von München durch die Brienner Straße, die Ludwig- und die Maximilianstraße. Ludwig II. überschuldete sich zwar mit seiner Bautätigkeit, aber davon sah man in München kaum etwas. Stattdessen entstanden die Königsschlösser Linderhof (Georg Dollmann, Neurokoko, 1870 – 1886), Neuschwanstein (Eduard Riedel, Neuromantik, 1869 – 1892) und Herrenchiemsee (Georg Dollmann, Neubarock, 1878 – 1886).
Dass sich der menschenscheue König kaum noch um Regierungsgeschäfte kümmerte, die Nacht zum Tag machte und seinen kostspieligen Schwärmereien nachhing, brachte das Kabinett unter dem leitenden Minister Johann Freiherr von Lutz dazu, 1886 die Absetzung des Königs zu betreiben. Der Psychiater Bernhard von Gudden und drei weitere Ärzte erklärten Ludwig II. am 8. Juni 1886 in einem ohne Untersuchung des Betroffenen erstellten Gutachten für »seelengestört«. Am Tag darauf entmündigte die Regierung in München den König, der sich in Neuschwanstein aufhielt. Dort wurde er am 12. Juni festgenommen und nach Schloss Berg am Ufer des Würmsees (heute: Starnberger See) gebracht. Am Tag darauf fand man die Leichen Ludwigs II. und Bernhard von Guddens unweit des Ufers im seichten Wasser des Sees. Bis heute ist unklar, wie die beiden ums Leben kamen.
Am 14. Juni 1886 wurde zwar Ludwigs jüngerer Bruder Otto formal König von Bayern, aber bei ihm hatte man bereits zehn Jahre zuvor »Wahnsinn« diagnostiziert. Er war also regierungsunfähig und lebte auf seinem Schloss Fürstenried, das der Hofgartenintendant Carl von Effner für den psychisch Kranken umgestaltet hatte. Ottos und Ludwigs Onkel Luitpold ‒ der jüngste Sohn König Ludwigs I. ‒ übernahm deshalb als »Prinzregent« die Staatsgeschäfte.
München Stadtgeschichte 1886 ‒ 1912
Prinzregent Luitpold
Ludwigs märchenhafter Wintergarten auf der Residenz musste wegen Einsturzgefahr des Unterbaus abgerissen werden. Neu errichtet wurden in den Gründerjahren einige repräsentative Bauwerke wie derJustizpalast (Friedrich von Thiersch*, 1891 – 1987), das → Bernheimer-Haus (Friedrich von Thiersch, 1887 – 1889), das → Münchner Künstlerhaus (Gabriel von Seidl*, 1893 – 1900), der Neubau für das Bayerische Nationalmuseum (Gabriel von Seidl, 1894 – 1900) und das Prinzregententheater (Max Littmann*, 1900/1901).
*) Mehr zu Max Littmann, Gabriel von Seidl und Friedrich von Thiersch im Album über Architekten
Album über den Justizpalast
25 Jahre nach dem Friedensschluss im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 stiftete das bayrische Herrscherhaus ein Denkmal. Der von der ionischen Korenhalle des Erechtheion auf der Athener Akropolis inspirierte Tempel mit dem Friedensengel wurde 1896 bis 1899 gebaut. Heinrich Düll*, Georg Pezold* und Max Heilmaier* gestalteten das Denkmal. Als Modell für die mit Blattgold beschichtete sechs Meter hohe Bronzefigur des Friedensengels wählten die Künstler eine 1822 in Pompeji ausgegrabene Nike-Statue aus hellenistischer Zeit.
*) Mehr zu Heinrich Düll, Max Heilmaier und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum





Aufgrund der Eingemeindungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, des Bevölkerungswachstums und des Wirtschaftsaufschwungs war das → Alte Rathaus in München längst zu klein geworden. Nachdem die Regierung von Oberbayern 1864 einen → Neubau in der Maximilianstraße bezogen hatte, erwarb die Stadt München die Amtsgebäude am Marienplatz, um dort ein Neues Rathaus zu bauen. Der deutsch-österreichische Architekt Georg Hauberrisser begann damit 1867 an der Nordostseite des Marienplatzes. Als der erste Trakt 1874 fertig wurde, zeichnete sich ab, dass das Rathaus über kurz oder lang schon wieder zu klein werden würde. Deshalb ließ die Stadt weitere Landschaftshäuser abreißen und beauftragte Georg Hauberrisser mit Erweiterungen, die in zwei weiteren Bauphasen von 1889 bis 1892 (im Nordosten) und von 1897 bis 1905 (im Westen) ausgeführt wurden. An der Fassade am Marienplatz fällt ein 1905 von Ferdinand von Miller d. J. entworfenes knapp drei Meter hohes Reiterstandbild des Prinzregenten Luitpold auf.



Album übers Neue Rathaus
Ulrich von Destouches (1802 – 1863) hatte 1843 vom Magistrat der Stadt München den Auftrag erhalten, alle Bücher im Bereich der kommunalen Behörden zu katalogisieren und zentral zu sammeln. 1866 war der erste Katalog mit 2375 Nummern fertig. Ab 1873 durften städtische Bedienstete auf eine erste Volksbibliothek der Stadt zugreifen, die erst Jahre später auch für die Allgemeinheit geöffnet wurde. Für die Bibliothek sah Georg von Hauberrisser im letzten Bauabschnitt des neugotischen Rathauses einen knapp zehn Meter hohen Jugendstil-Lesesaal vor, der 1905 fertiggestellt und im Jahr darauf seiner Bestimmung übergeben wurde (heute: Juristische Bibliothek).
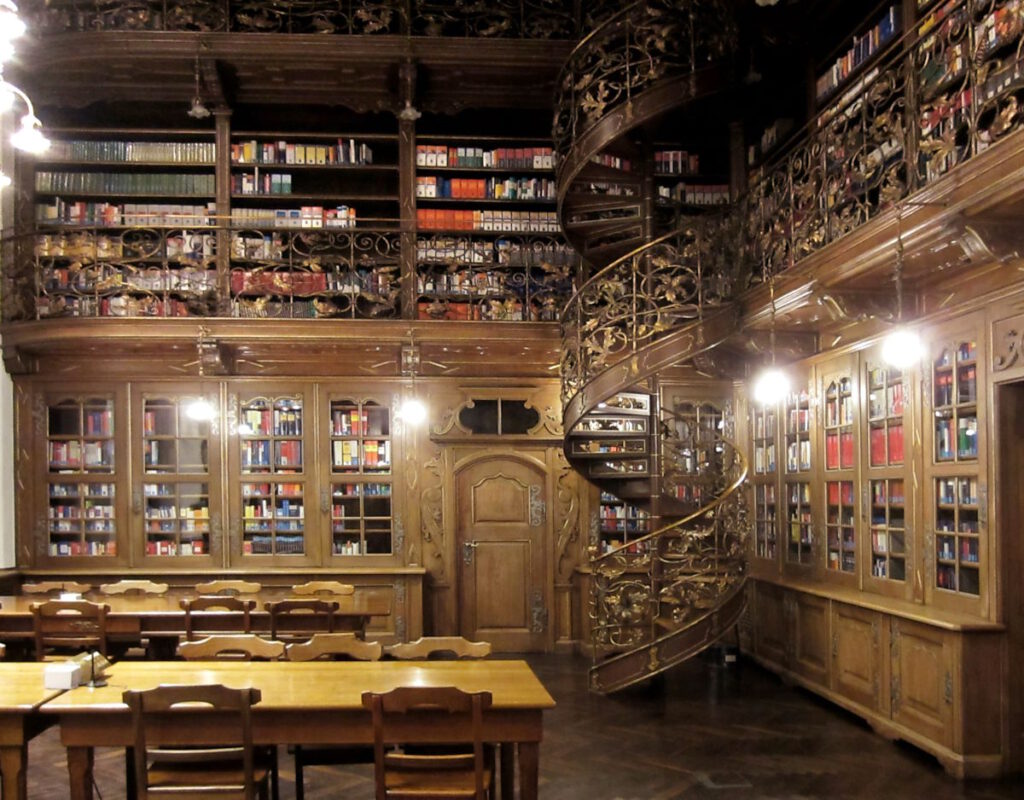

1890 wurde Schwabing – seit vier Jahren selbst Stadt – von München eingemeindet. In der Regierungszeit des Prinzregenten Luitpold entwickelte sich dort ein Künstler- und Literaten-Viertel, eine Bohème im Kontrast zum Spießbürgertum. Die exzentrischen Dichter Rainer Maria Rilke und Stefan George zählten zu den Mitgliedern eines Intellektuellen- und Künstlerkreises, den Franziska Gräfin zu Reventlow ab 1893 in Schwabing (»Wahnmoching«) um sich scharte.
Albert Langen und Thomas Theodor Heine gründeten 1896 in Schwabing den »Simplicissimus«, eine politisch-satirische Wochenzeitschrift, die immer wieder durch ihre beißende Kritik an Prominenten in München und Berlin Skandale auslöste. Gerhart Hauptmann nannte das Blatt »die schärfste und rücksichtsloseste satirische Kraft Deutschlands«. Der »Simplicissimus« existierte bis 1944 und erschien dann noch einmal von 1954 bis 1957 und 1980.
Frank Wedekind wurde 1864 in Hannover geboren. In München begann er 1884 Jura zu studieren. Er wirkte von Anfang an beim »Simplicissimus« mit. Aufgrund eines Spottgedichts auf Kaiser Wilhelm II. wurde er im August 1899 wegen Majestätsbeleidigung zu sieben Monaten Festungshaft verurteilt. In dem 1901 gegründeten Münchner Kabarett »Die Elf Scharfrichter« trug er eigene Lieder und satirische Balladen vor. Darin attackierte er – wie auch in seinen expressionistischen Dramen – die Pseudomoral des wilhelminischen Spießbürgertums und protestierte gegen die Unterdrückung eines freizügigen Lebens.


Die Wedekind-Grabstätte mit Pegasus und Bronzerelief von Benno Elkan befindet sich auf dem Waldfriedhof.
Unweit der Gaststätte in der Türkenstraße, in der die »Elf Scharfrichter« auftraten, eröffnete die ehemalige Kellnerin Kathi Kobus am 1. Mai 1903 ein Künstlerlokal, das wenig später nach dem »Simplicissimus« benannt wurde. Als Texter des »Simpl« kam der Sachse Joachim Ringelnatz 1909 nach München und blieb dort bis zum Ersten Weltkrieg.
Das Renommee der Münchner Kunstakademie wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts nur von dem der Pariser Kunsthochschule übertroffen. In der bayerischen Residenzstadt beherrschte nach dem Tod von Karl Theodor von Piloty im Jahr 1886 dessen Schüler Franz Lenbach die Kunstszene. Für den – 1882 geadelten – Münchner »Malerfürsten« baute Gabriel von Seidl* 1887 bis 1891 einen Palazzo im italienischen Renaissancestil: das Lenbachhaus.
*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten
Album übers Lenbachhaus
Der niederbayerische Müllersohn Franz Stuck erhielt bei der »Münchner Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen« 1889 im Münchner Glaspalast die Goldmedaille. Trotzdem rebellierte er 1892 zusammen mit anderen jungen Malern gegen die Dominanz Lenbachs und gründete mit ihnen die »Münchner Secession«, die ihre Werke in einer Galerie in der Prinzregentenstraße ausstellte.
Franz von Stuck, der 1895 zum Direktor der Münchner Akademie berufen worden war, richtete die nach eigenen Entwürfen 1897/98 vom Bauunternehmen Heilmann & Littmann errichtete neoklassizistische Villa in der Prinzregentenstraße ausschließlich mit eigenen Kunstgegenständen und selbstentworfenen Möbeln ein. Dabei kombinierte Franz von Stuck Stilelemente aus Antike, Byzanz, Orient und Hochrenaissance mit Entwicklungen des späten 19. Jahrhunderts zu einem eigenständigen Gesamtkunstwerk mit theatralischer Wirkung.
Album über die Villa Stuck
Aus der »Münchner Secession« ging der Jugendstil hervor, der deutsche Zweig einer in London wurzelnden Stilwende nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch im Kunsthandwerk, im Design von Gebrauchsgegenständen, in der Raumgestaltung und in der Architektur. (In England spricht man vom »Modern Style«, in Frankreich von »Art Nouveau«.) Die deutsche Bezeichnung geht auf die 1896 erstmals erschienene Zeitschrift »Jugend« des Münchner Verlegers Georg Hirth zurück, der auch den Auszug der Sezessionisten aus dem Glaspalast unterstützt hatte. Kennzeichen des Jugendstils sind halbabstrakt verwendete, natürliche Formen, rankende und vegetabilische, fließend bewegte, dekorativ-ornamentale Linienführungen, ein präraffaelitisches Schönheitsideal und symbolistische Ideen.
Alben über Jugendstil in München bzw. Jugendstil in Schwabing
Die Moderne Galerie von Heinrich Thannhauser im 1908 bis 1910 gebauten → Arco-Palais veranstaltete 1909 die erste Ausstellung der »Neuen Künstlervereinigung München« und vom 18. Dezember 1911 bis 1. Januar 1912 die erste Ausstellung des »Blauen Reiter«. »Der Blaue Reiter« entstand 1911 als Abspaltung (Sezession) von der zwei Jahre zuvor gegründeten »Neuen Künstlervereinigung München«. Die Farbe Blau assoziierte der Gründer Franz Marc mit dem Herben, Geistigen und Männlichen. Zwar verwendeten auch die Mitglieder des Münchner Kreises die Farben abstrakt, flächenhaft und als reine Ausdruckswerte, aber ihnen kam es nicht wie den Fauvisten und den norddeutschen Expressionisten auf den heftigen Ausdruck an. Franz Marc, Wassily Kandinsky und der aus dem Rheinland stammende August Macke redigierten von 1912 bis zum Ersten Weltkrieg den Almanach »Der Blaue Reiter«. Die im Umfeld des »Blauen Reiter« tätigen expressionistischen Künstler bildeten keine Künstlergruppe im engeren Sinne wie die »Brücke« in Dresden, sondern ein lockeres Beziehungsnetz der Avantgarde. (Über die weltweit größte Sammlung zur Kunst des »Blauen Reiter« verfügt das Lenbachhaus München.)
Als von Juni 1873 bis April 1874 eine weitere Cholera-Epidemie in München knapp 1500 Menschen das Leben kostete, hörte der Magistrat endlich auf Max von Pettenkofer, der bereits 1854 Mitglied des »Komitees zur Beschließung von Maßnahmen gegen die epidemische Brechruhr« gewesen war. Der Mediziner, Physiologe und Epidemiologe, Chemiker und Apotheker hatte 1865 an der → Ludwig-Maximilians-Universität in München den weltweit ersten Lehrstuhl für Hygiene eingerichtet und baute 1876 bis 1879 das später nach ihm benannte Hygieneinstitut. Der als »Scheißhaus-Apostel« verunglimpfte Hygieniker empfahl den Bau eines Zentralschlachthofs und einer Schwemmkanalisation, weil er Luft- und Bodenverschmutzungen für die Ursache von Epidemien hielt. Als der Mikrobiologe Robert Koch 1883/84 den Kommabazillus als Erreger der Cholera nachwies, mochte Max von Pettenkofer das nicht glauben. Um Robert Koch zu widerlegen, nahm er 1892 vor Zeugen etwas von einer Cholera-Kultur zu sich – und erkrankte aus unbekannten Gründen nicht.

das 1909 ‒ drei Jahre nach dem Tod des Künstlers ‒
auf dem Maximiliansplatz enthüllt wurde.
1875 versorgten Stadt- und Hofbrunnwerke 69 öffentliche Brunnen und weniger als die Hälfte der Häuser in München mit Grundwasser ‒ und das war aufgrund fehlender Kanalisation nicht immer sauber. Max von Pettenkofer erreichte zunächst, dass die seit dem 15. Jahrhundert in »Wasserstuben« erschlossenen Thalkirchner Quellen durch ein 1864 bis 1866 gebautes Brunnhaus (Pettenkoferbrunnhaus) für die Wasserversorgung Münchens besser nutzbar gemacht wurden. Wichtiger noch: Seit 1883 stammt der größte Teil des Münchner Trinkwassers aus dem Mangfalltal. (In der Münchner Schotterebene wurde 1949 bis 1954 ein weiteres Wassereinzugsgebiet erschlossen.) Die Fertigstellung dieser Leitung feierte München mit dem 1893 bis 1895 auf Resten der Stadtbefestigung nach Entwürfen des Bildhauers Adolf von Hildebrand** errichteten klassizistischen Wittelsbacher Brunnen.
Mit dem Bau der ebenfalls von Max von Pettenkofer initiierten Schwemmkanalisation wurde 1881 begonnen. Zu den von ihm empfohlenen Hygiene-Maßnahmen gehörte auch eines Schlacht- und Viehhofs, der 1876 bis 1878 in der Isarvorstadt (Schlachthofviertel) gebaut wurde, und zwar nach Entwürfen des Stadtbaurats Arnold von Zenetti* (1824 – 1891, geadelt: 1890) wie das Pettenkofer-Brunnhaus.
*) Mehr zu Arnold von Zenetti im Album über Architekten
**) Mehr zu Adolf von Hildebrand im Album über Brunnen
Die zweite Internationale Elektrizitätsausstellung fand 1882 im Münchner Glaspalast stattfand. Oskar von Miller zeigte dort einen Elektromotor, der eine Wasserpumpe betrieb. Der erforderliche Gleichstrom wurde von einem Dynamo in Miesbach erzeugt. Es war die weltweit erste Gleichstrom-Fernübertragung. Um zu zeigen, was möglich war, wurden während der Ausstellung mehrere Straßen und die Türme der Frauenkirche elektrisch beleuchtet.
Aber der Genfer Bankier Christian Friedrich Kohler hatte 1848 ein Monopol für eine mit Steinkohlegas betriebene Straßenbeleuchtung in München erhalten, daraufhin an der Thalkirchner Straße eine erste Gastanstalt gebaut und 1850 die ersten tausend Gaslaternen in Betrieb genommen. Am Einspruch der Gasbeleuchtungsgesellschaft, deren Monopol bis 1899 gültig blieb, scheiterte zunächst der Aufbau einer elektrischen Straßenbeleuchtung in München.
Die damals noch nicht eingemeindete Stadt Schwabing führte 1887 eine elektrische Straßenbeleuchtung ein, und 1891 verständigte sich die Stadt München mit der Gasbeleuchtungsgesellschaft auf einen Kompromiss für die Restlaufzeit des Monopols: In begrenztem Umfang wurde nun auch in München mit einer elektrischen Straßenbeleuchtung begonnen. Den erforderlichen Strom erzeugte das Westenrieder Wasserkraftwerk, das als erstes städtisches Elektrizitätswerk 1893 in Betrieb genommen wurde. In den beiden folgenden Jahren kamen das → Muffat- und das → Maximilianswerk (Maxwerk) dazu.
Als das Monopol der Gasbeleuchtungsgesellschaft auslief, übernahm die Stadt München die Energieversorgung und ersetzte die Gaslaternen schrittweise durch eine elektrische Straßenbeleuchtung.
August Ungerer (1860 – 1921) hatte 1886 auf einer 776 Meter langen Strecke zum Würmbad am Würmkanal (heute: Ungerer Bad am Biedersteiner Kanal) die erste elektrische Bahn in München – die dritte in Deutschland – in Betrieb genommen. Sie fuhr neun Jahre lang. Eine elektrische Straßenbahn ersetzte 1895 die Pferdetrambahn zwischen dem Färbergraben und dem Isartalbahnhof. 1907 übernahm die Stadt München den öffentlichen Personennahverkehr und baute zur Stromerzeugung Wasserkraftwerke an der Isar: 1906 bis 1908 das Isarwerk 1, 1921 bis 1923 die Isarwerke 2 und 3.
Die Isar ist ein Wildfluss. Das keltische Wort »isaria« ließe sich mit »reißend« übersetzen. Am 13. September 1813 waren mehr als hundert Menschen gestorben, als ein Hochwasser die Isarbrücke am Gasteig (heute: → Ludwigsbrücke) weggerissen hatte, und bei einem Hochwasser am 13. September 1899 stürzten die → Luitpold- und die → Max-Joseph-Brücke ein. Um die Isar zu bändigen, wurde das Flussbett in München im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingedämmt, begradigt und kanalisiert.


Die ab 1286 vom Münchner Rat geregelte Flößerei auf der Isar erreichte ihren Höhepunkt mit der Industrialisierung: Zwischen 1860 und 1876 kamen in den meisten Jahren mehr als 8000 Flöße nach München; 1864 waren es sogar 11.145. Aber bald darauf verdrängte die Eisenbahn die Flöße als Transportmittel.
Von der Unteren Floßlände, der früheren Hauptanlagestelle für Flöße in München, zeugt heute nur noch die Ländstraße im Lehel. Die Flöße selbst wurden zu Bauholz zerlegt, und das lagerte man ebenso wie die transportierte Kohle auf der Sandbank in der Isar, deren nördlicher Teil bis zur Unteren Floßlände reichte (»Kohleninsel«). Nachdem die Trift von Brennholz bereits 1870 eingestellt worden war, gab man auch die Untere Floßlände auf, um 1891 bis 1898 das linke Isarufer begradigen und entlang der Erhardt-, Steinsdorf- und Widenmayerstraße – alle drei Straßen nach Münchner Bürgermeistern benannt ‒ Kaimauern bauen zu können.
Eine Obere Lände gab es sowohl flussaufwärts an der Isar als auch am oberirdischen Ende des Westermühlbachs in der Isarvorstadt. Das Holzlager dort gab dem → Holzplatz und der Holzstraße den Namen.
Als Ersatz für die anderen Floßländen in München wurde 1899 die 400 Meter lange Zentrallände am Ende des Floßkanals in Thalkirchen gebaut, die heute noch von der touristischen Flößerei auf der Isar genutzt wird.


Album über die Isar
Oskar von Miller gründete 1903 das Deutsche Museum in München, für das die Stadt im Jahr darauf eine Insel in der Isar zur Verfügung stellte. 1906 legte Kaiser Wilhelm II. persönlich den Grundstein für das von Gabriel von Seidl* gebaute Museumsgebäude. Die mathematisch-physikalische Sammlung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften bildete den Grundstock des mit Industriespenden und staatlichen Mitteln finanzierten »Museums von Meisterwerken der Naturwissenschaft und der Technik«, auf dessen Eröffnung allerdings noch bis 1925 gewartet werden musste.
*) Mehr zu Gabriel von Seidl im Album über Architekten


Album übers Deutsche Museum München
Viele er neuen Errungenschaften Münchens fielen in die Amtszeit von Wilhelm von Borscht (1857 – 1943, geadelt: 1911), der von 1888 bis 1893 Zweiter Bürgermeister, anschließend bis 1918 Erster Bürgermeister von München war und die Stadtentwicklung entscheidend voranbrachte. 1907 nannte ihn Prinzregent Luitpold Oberbürgermeister – und führte so diesen Titel ein.
Längst hatte in München und in den Vorstädten die Industrialisierung begonnen.
Haidhausen galt bei der Eingemeindung 1854 noch als Bauern- und Ziegelbrennerdorf. Schon 1475 soll es 60 städtische Ziegelstadel und Brennöfen in Haidhausen gegeben haben. Von Haidhausen hatten sich die Ziegeleien über Berg am Laim nach Oberföhring ausgebreitet.
Weil Deutsche es während der Industrialisierung vorzogen, besser bezahlte Arbeit in Fabriken zu leisten, begannen die Ziegeleien auf der Lehmzunge Mitte des 19. Jahrhunderts, italienische Saisonarbeiter zu beschäftigen, vor allem aus dem Friaul. Angeworben wurden sie nicht vom Ziegeleibesitzer, sondern von einem als »Akkordant« bezeichneten Subunternehmer. Bis Udine 1877 ans Eisenbahnnetz angeschlossen wurde, überquerten die Menschen die Alpen zu Fuß.

Der Bildhauer Hans Osel gestaltete 1978 den Ziegelbrenner-Brunnen aus Muschelkalk,
der vor der Johanneskirche auf dem Preysingplatz steht. Dargestellt sind ein Ziegelträger und ein Ziegelschläger.
Album über Ziegelbrenner und Lehmbarone
Von 1800 bis zum Ersten Weltkrieg verfünfzehnfachte sich die Münchner Bevölkerung. Allein in Haidhausen schnellte die Bevölkerungszahl von 6000 Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Jahrhundertwende auf 50.000 hoch. Ein 16-Stunden-Arbeitstag war ebenso »normal« wie Kinderarbeit. Um die Wohnungsnot zu lindern, durften durften Arbeiter und Handwerker in Haidhausen ab 1789 gemeinsam Häuser bauen und das Eigentum unter sich aufteilen (»Bruchteilseigentum«). Diese »Herbergen« waren Vorläufer der modernen Eigentumswohnungen ‒ nur viel bescheidener: Die Bewohner eines »Herbergshauses« teilten sich die Wasserpumpe ebenso wie das Plumpsklo im Hof, und manche Familien vermieteten ihr Bett schichtweise an »Bettgeher«.
Unter Prinzregent Luitpold bahnte sich eine Zeitenwende an: 1892 wurde ein bayrischer Landesverband der SPD gegründet, und im Jahr darauf bildete die SPD erstmals eine Fraktion im Bayerischen Landtag. Den Vorsitz sowohl der Partei als auch der Fraktion übte Georg von Vollmar bis 1918 aus.
Drei Jahre nach Baden und fünf Jahre vor Preußen ließ das Königreich Bayern ab 1903 Frauen zum Universitätsstudium zu. Als erste Frau in Deutschland habilitierte sich die Medizinerin Adele Hartmann 1918 in München.
SPD und Zentrum setzten 1906 in München ein Landtagswahlgesetz durch, mit dem die direkte Wahl der Abgeordneten der zweiten Kammer des Bayerischen Landtags eingeführt wurde. Allerdings durften noch immer nur Männer wählen, die mindestens 25 Jahre alt waren und direkte Steuern zahlten.
Als Prinzregent Luitpold 1912 im Alter von 91 Jahren starb, reiste Kaiser Wilhelm II. aus Berlin an und hielt eine Trauerrede in der Theatinerkirche.
Wilhelm von Rümann* schuf 1883 ein Denkmal für Luitpold von Bayern (das seit 1930 auf dem Schäringerplatz in Neuhausen steht) und 1897 eine Statue des Prinzregenten für die Zentralhalle im Justizpalast. Adolf von Hildebrand** und sein Schüler Theodor Georgii** gestalteten 1901 bis 1913 das neubarocke Reiterstandbild in der Prinzregentenstraße. Und Josef Henselmann* modellierte 1983 den → Prinzregent-Luitpold-Brunnen vor dem → Luitpoldblock in der Brienner Straße.
**) Mehr zu Josef Henselmann und Wilhelm von Rümann im Album über Brunnen
**) Mehr zu Theodor Georgii und Adolf von Hildebrand im Album über Kunst im öffentlichen Raum




München Stadtgeschichte 1912 ‒ 1921
Aus dem Königreich Bayern wird ein Freistaat
Luitpolds ältester Sohn Ludwig von Wittelsbach folgte ihm zunächst ebenfalls als Prinzregent. Aus Rücksicht auf König Otto, der nach wie vor geistig umnachtet im Schloss Fürstenried lebte, zögerten maßgebliche Politiker, die Nachfolge zu regeln. Erst am 4. November 1913 beendete ein Gesetz die Zeit der Regentschaft, und am darauffolgenden Tag huldigten die Münchner ihrem neuen König Ludwig III.
Neun Monate später, am 1. August 1914, verkündete König Ludwig III. vom Balkon des Wittelsbacher Palais die Mobilmachung – und die Menge jubelte. Der Erste Weltkrieg begann. Gemäß der Verträge wurde die auf den bayrischen König vereidigte Armee dem deutschen Kaiser unterstellt. Ein Bündnis aus dem Deutschen Kaiserreich, Österreich-Ungarn, Italien und Rumänien stand der Triple Entente Frankreich, Großbritannien und Russland gegenüber.
Mit der Eröffnung eines Rüstungsbetriebs der Bayerischen Geschützwerke Friedrich Krupp KG entwickelte sich Freimann 1916 zum Industriestandort. Die Münchner Lokomotiven-Hersteller Maffei und Krauss rüsteten ihre Betriebe ebenfalls für die Kriegswirtschaft um.
Der rasche Sieg, der bei Kriegsbeginn erwartet worden war und zur Kriegsbegeisterung auch in München geführt hatte, blieb aus. Die Stimmung kippte. Und die Entwicklung verschärfte sich durch die Hungersnot im Winter 1916/17 (»Dotschenwinter«), die Mitursache einer Grippewelle wurde, der Tausende zum Opfer fielen.
Der Journalist und Schriftsteller Kurt Eisner, der sich im Verlauf des Kriegs zum Pazifisten gewandelt hatte, organisierte Anfang 1918 einen Streik der Munitionsarbeiter in München. Ein Gericht verurteilte ihn deshalb zu einer Haftstrafe, aber im Oktober kam er vorzeitig frei – und rief am 7. November 1918 bei einer Friedensdemonstration auf der → Theresienwiese zur Revolution auf (»Novemberrevolution«). Am nächsten Tag proklamierte er im Landtag den »Freistaat Bayern«, und der »Rat der Arbeiter, Soldaten und Bauern« wählte eine Koalitionsregierung mit Kurt Eisner (USPD) als Ministerpräsidenten und Georg von Vollmars Nachfolger Erhard Auer (MSPD) als Innenminister.
Auch als Monarch ging Ludwig III. sorglos durch München. Ein Bürger soll ihn im → Hofgarten angesprochen haben: »Majestät, gengan’S hoam, Revolution is‘!« König Ludwig III. floh aus der Münchner Residenz zunächst zum Schloss Wildenwart am Chiemsee, dann weiter zum Schloss Anif bei Salzburg. Er dankte zwar nicht ab, aber faktisch hörte nach 738 Jahren die Herrschaft der Wittelsbacher in Bayern auf, und die Monarchie existierte nicht mehr.
Am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg mit dem Waffenstillstand von Compiègne. Zwei Tage zuvor hatten Philipp Scheidemann (SPD) und Karl Liebknecht (Spartakusbund) in Berlin eine »deutsche« bzw. »freie sozialistische« Republik ausgerufen. Ohne eine Entscheidung Kaiser Wilhelms II. abzuwarten, hatte der Reichskanzler Max von Baden erklärt: »Der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Throne zu entsagen.«
Die neue Regierung in München führte außer dem Acht-Stunden-Arbeitstag das allgemeine, freie und gleiche Wahlrecht für Männer und Frauen in Bayern ein. Bei der Landtagswahl im Januar 1919 wählten deshalb erstmals auch Frauen. Aber die USPD, der Kurt Eisner angehörte, erhielt gerade einmal 2,5 Prozent der abgegebenen Stimmen.
Deshalb wollte der Ministerpräsident am 21. Februar 1919 seinen Rücktritt erklären. Auf dem Weg zum Landtag in der Prannerstraße wurde er in der heute nach Kardinal Faulhaber benannten Straße von Anton Graf von Arco auf Valley erschossen.
Alois Lindner, ein Anhänger Kurt Eisners, stürmte daraufhin in die konstituierende Sitzung des neugewählten Landtags und schoss gezielt auf den Innenminister Erhard Auer, den er irrtümlich für den Drahtzieher des Attentats hielt. Erhard Auer überlebte schwer verletzt; zwei Abgeordnete starben durch Schüsse.


In dieser kritischen Lage wurde am 7. April 1919 in München eine Räterepublik ausgerufen, und die am 17. März gewählte Regierung unter Ministerpräsident Johannes Hoffmann (MSPD) floh nach Bamberg. Die Macht der Bayerischen Räterepublik blieb allerdings auf München beschränkt (»Münchner Räterepublik«). Pazifistische und anarchistische Intellektuelle führten die Bewegung zunächst an, wurden aber nach einer Woche von Kommunisten und Rotgardisten in den Hintergrund gedrängt.





Kurt Eisner, Sarah Sonja Rabinowitz (Lerch), Erich Mühsam, Gustav Landauer und Ernst Toller.
Die von der Regierung in Bamberg aus mobilisierten Freikorpsverbände wurden in ihrem Kampf gegen die Rote Armee der Räterepublik in München von regulären Armee-Einheiten des Reichs verstärkt. Diese beendeten die Bayerische bzw. Münchner Räterepublik Anfang Mai 1919 gewaltsam mit Hunderten von Toten.
Weil sich jüdische Intellektuelle wie Gustav Landauer, Erich Mühsam und Ernst Toller in den revolutionären Vorgängen engagiert hatten, sprachen Antisemiten von einer Verschwörung des »Weltjudentums«, und der Volksschriftsteller Ludwig Thoma behauptete, das Münchner Proletariat sei von jüdischen Intellektuellen in die Irre geleitet worden (»Die große Münchner Revolution anno 1919«).
Die Reichswehrführung zwang den bayrischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann im März 1920 zum Rücktritt. Zu seinem Nachfolger wählte der Landtag Gustav Ritter von Kahr (Bayerische Volkspartei, BVP), einen Nationalisten, der die linke Reichsregierung verabscheute (»Novemberverbrecher«) und eine Autonomie Bayerns anstrebte. Unter seiner Führung entwickelte sich Bayern zur konservativ-nationalistischen »Ordnungszelle« der Weimarer Republik.
Aber im September 1921 sah sich auch Gustav von Kahr zur Demission gezwungen.
München Stadtgeschichte 1913 ‒ 1932
Hitlers Aufstieg in München
Der Österreicher Adolf Hitler, dessen Bewerbung an der Allgemeinen Malerschule der Wiener Kunstakademie 1907 gescheitert war, lebte in Obdachlosenasylen in Wien und verdiente mit Kopien von Ansichtskarten etwas Geld. Um der militärischen Dienstpflicht in Österreich zu entgehen, zog er im Mai 1913 nach München (nicht im Frühjahr 1912, wie er selbst behauptete). Dort nahm ihn die Kriminalpolizei im Januar 1914 fest. Die Musterung in Salzburg endete mit seiner Zurückstellung vom Wehrdienst, aber als der Erste Weltkrieg ausbrach, ließ sich Hitler als Kriegsfreiwilliger von der bayrischen Armee aufnehmen und auf den König vereidigen. Im November 1918 kehrte er nach München zurück, blieb aber noch bis März 1920 Soldat.
Im September 1919 besuchte Hitler erstmals eine Versammlung der am 5. Januar gegründeten Deutschen Arbeiterpartei (DAP) in München. Deren Gründer Anton Drexler (1884 – 1942) strebte keine öffentliche Partei an; er bevorzugte eine politische Stammtischrunde, die sich einmal in der Woche im Sterneckerbräu traf. Hitler sollte die neue Gruppierung – wohl als V-Mann – für die Reichswehr ausspähen, aber stattdessen akzeptierte er die angebotene Mitgliedskarte und wurde Werbeobmann der DAP.
Auf der ersten Großveranstaltung der Deutschen Arbeiterpartei, am 24. Februar 1920 im großen Saal des Hofbräuhauses, stellte Hitler 2000 Zuhörern das neue Parteiprogramm vor, das beispielsweise darauf abzielte, den Versailler Friedensvertrag aufzuheben, die Volksgemeinschaft zu stärken und Juden die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Eine Woche später änderte die Partei ihren Namen und hieß fortan »Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei« (NSDAP). Als Emblem wählte die NSDAP das Hakenkreuz, ein uraltes Symbol, das um die Jahrhundertwende von deutschen und österreichischen Nationalisten übernommen worden war.
Einen Konflikt über den Kurs der Partei trieb Adolf Hitler absichtlich auf die Spitze, indem er am 11. Juli 1921 austrat und drei Tage später die Bedingungen für seine Rückkehr in die NSDAP nannte. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung bestätigte am 29. Juli seinen Sieg: Nach einer Satzungsänderung, die den Parteivorsitzenden mit diktatorischen Befugnissen versah, übernahm Adolf Hitler dieses Amt, während Anton Drexler als »Ehrenvorsitzender« aufs Abstellgleis geschoben wurde.
Am 3. August 1921 ließ Hitler den Saalschutz der NSDAP von ehemaligen Freikorpsführern zur paramilitärischen »Sturmabteilung« (SA) ausbauen. Die SA schützte eigene Parteiveranstaltungen, sprengte die der Gegner, provozierte blutige Saal- und Straßenschlachten, und ihre Lieder singenden Marschkolonnen warben in den Straßen für die NSDAP. Hitler war überzeugt, dass auch die Krawalle neue Mitglieder anlockten. Den legendären Ruf einer draufgängerischen, rücksichtslosen Kampftruppe erwarb die SA bereits am 4. November 1921 mit der »Schlacht im Hofbräuhaus«.
Ihren ersten Reichsparteitag veranstaltete die NSDAP im Januar 1923 in München.
Die Untergangsstimmung, die sich in München nicht zuletzt wegen 60.000 Arbeitsloser ausbreitete (die Zahl stieg bis 1933 auf 90.000), wollte Hitler für den Sturz der Reichsregierung nutzen. Nach dem Vorbild des »Marsches auf Rom« im Oktober 1922, der zur Machtübernahme Benito Mussolinis geführt hatte, sollte der ehemalige Generalstabschef Erich Ludendorff einen Marsch von München nach Berlin anführen.
Nachdem Hitler am 30. Oktober 1923 erfolglos im Zirkus Krone zum Putsch aufgerufen hatte, nutzte er eine politische Kundgebung am 8. November 1923 im Bürgerbräukeller, bei der auch eine Rede Gustav von Kahrs geplant war, der seit September als Generalstaatskommissar mit diktatorischen Vollmachten in München regierte. Eine halbe Stunde nach dem Beginn der Veranstaltung stürmte Hitler mit Begleitern in den Saal, schoss mit einer Pistole oder einem Revolver in die Decke und verkündete eine »nationale Revolution« (»Hitler-Putsch«). Während Hermann Göring, der Kommandeur der Sturmabteilung (SA), eine Rede hielt, brachten Hitler und General Erich Ludendorff nicht nur Gustav von Kahr, sondern auch den Landeskommandanten der Reichswehr in Bayern, Otto von Lossow, und den Chef der Bayerischen Landespolizei, Hans Ritter von Seißer, in einem Nebenraum dazu, sich für die Revolution auszusprechen und das dann auch im Saal öffentlich zu bestätigen. In einem Flugblatt hieß es: »Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden. Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet worden, diese besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow, Oberst von Seißer.«
Unter Führung von Rudolf Hess nahm ein SA-Kommando den Ministerpräsidenten Eugen von Knilling, drei Minister, den Münchner Polizeipräsidenten und andere Persönlichkeiten im Bürgerbräukeller bzw. im Landhaus des Verlegers Julius Friedrich Lehmann in der Menterschwaige als Geiseln.

Aber General Otto von Lossow beorderte noch in Nacht regierungstreue Truppen nach München, und Gustav von Kahr erklärte im Rundfunk, Hitler habe nicht nur ihn, sondern auch Otto von Lossow und Hans Ritter von Seißer mit vorgehaltener Pistole zu den Erklärungen im Bürgerbräukeller erpresst. In dieser Lage übertrug Reichspräsident Friedrich Ebert die vollziehende Gewalt im Reich vom (zivilen) Reichswehrminister Otto Geßler auf General von Seeckt, den Chef der Heeresleitung.
Um die Bevölkerung für den Putsch zu gewinnen, führten Hitler und Ludendorff am 9. November einen Propagandazug vom Bürgerbräukeller über die → Ludwigsbrücke zum Marienplatz. Sie wollten zum Wehrkreiskommando nördlich des → Odeonsplatzes, das Ernst Röhm, der Gründer des Bundes »Reichskriegsflagge«, in der Nacht für die Putschisten besetzt hatte.
Hans Ritter von Seißer befahl, den Odeonsplatz abzuriegeln. Die Putschisten marschierten durch die Residenzstraße und wollten neben der → Feldherrnhalle eine Absperrkette der Polizei durchbrechen. Bei der Schießerei kamen vier Polizisten, ein Zuschauer und 13 Putschisten ums Leben. (Zusätzliche Tote gab es im weiteren Verlauf.)
Hitler floh daraufhin zum Landhaus der Familie Ernst und Helene Hanfstaengl in Uffing am Staffelsee, wo ihn die Polizei aber am 11. November festnahm. Die NSDAP wurde verboten.
Beim Prozess gegen Hitler vor dem Volksgericht in München im Frühjahr 1924 sorgte der bayrische Justizminister Franz Gürtner dafür, dass Hitler eine Bühne bekam und sich in seinen Reden als Führer der völkisch-nationalen Bewegung und verratener Patriot stilisieren konnte. Am Ende wurde der Angeklagte zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Davon verbüßte Hitler neun Monate in der Festung Landsberg, und diese Zeit nutzte er, um Mithälftlingen den ersten Band seines Buches »Mein Kampf« zu zu diktieren.
Nach seiner Freilassung setzte Hitler nicht mehr auf einen Umsturz, sondern richtete seine Strategie auf einen legalen Weg zur Machtübernahme aus. Dazu gründete er die NSDAP im Februar 1925 neu. Die desolate Lage vieler Menschen in der Weltwirtschaftskrise nutzte er, um seine Partei als Alternative zu den etablierten Parteien darzustellen. Tatsächlich erhielt die NSDAP bei der Reichstagswahl im August 1932 die meisten Stimmen (37,4 %). Bei der nächsten Reichstagswahl, die bereits im November 1932 stattfand, büßte die NSDAP zwar Stimmen ein (33,1 %), blieb jedoch die stärkste Fraktion. In München verbesserte die NSDAP ihr Wahlergebnis bei den Stadtratswahlen von 5,9% (1924) auf 15,4% (1929), bei den Landtagswahlen von 6,1% (1928) auf 32,5% (1932) und bei den Reichstagswahlen von 2,5% (1928) auf 18,3% (1930).
München Stadtgeschichte 1933 ‒ 1945
München: »Hauptstadt der Bewegung«
Reichspräsident Paul von Hindenburg ernannte Hitler – der seit 1932 deutscher Staatsbürger war – am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Schritt für Schritt (darunter die Reichstagsbrand-Notverordnung vom 28. Februar und das Ermächtigungsgesetz vom 24. März) mutierte der demokratische Staat in eine Diktatur.
In München versuchten Ministerpräsident Heinrich Held und Oberbürgermeister Karl Scharnagl, die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Bayern (»Gleichschaltung«) zu verhindern. Aber Wilhelm Frick. der Reichsinnenminister, übertrug die vollziehende Gewalt in Bayern am 9. März 1933 Franz Ritter von Epp, der so zum Reichskommissar wurde. Am selben Tag vertrieben die Nationalsozialisten den letzten rechtmäßig gewählten Münchner Stadtrat. Zwei der Eindringlinge entrollten eine überdimensionale Hakenkreuzfahne am Turm des Neuen Rathauses in München. Heinrich Held und Karl Scharnagl blieb nichts anderes übrig, als sich ins Privatleben zurückzuziehen.
Heinrich Himmler – seit 1929 »Reichsführer-SS« – amtierte vom 9. März bis 13. April 1933 als Polizeipräsident von München und löste in dieser Zeit die »Bayerische Politische Polizei« als selbstständige und fürs ganze Land zuständige Organisation aus der Münchner Polizei heraus. Und am 21. März eröffnete er auf dem Gelände der stillgelegten Königlichen Pulver- und Munitionsfabrik Dachau ein für 5000 Häftlinge konzipiertes Konzentrationslager (»Schutzhaftlager«), um politische Gegner wegzusperren und die Bevölkerung einzuschüchtern.
Album über die KZ-Gedenkstätte Dachau
Zum Abschluss eines Fackelzugs verbrannten die Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 auf dem Münchner → Königsplatz Bücher zum Beispiel von Bertolt Brecht, Erich Kästner und Heinrich Mann, die sie für »undeutsch« hielten. Zehntausende jubelten.
Am 9. November 1933, dem zehnten Jahrestag des gescheiterten Hitler-Putsches, enthüllte der »Führer« östlich der → Feldherrnhalle ein Denkmal, und von da an mussten Passanten dort den Hitlergruß zeigen. Wer das vermeiden wollte, konnte auf dem Weg von der Residenzstraße zum → Odeonsplatz vor dem → Preysing-Palais in die → Viscardigasse abbiegen, die deshalb hinter vorgehaltener Hand »Drückebergergassl« genannt wurde.


Um den Königsplatz herum richteten sich die zentralen Organe der NSDAP ein. Das begann mit der Parteizentrale im »Braunen Haus« an der Brienner Straße. Dabei handelte es sich um einen 1828 von Jean Baptiste Métivier für Karl Freiherr von Lotzbeck errichteten klassizistischen Adelspalast, der 1876 in den Besitz der Familie Barlow gekommen war (»Barlow-Palais«) und nach dem Tod des Industriellen Willy Barlow (1869 – 1928) von dessen Witwe 1930 der NSDAP verkauft wurde, deren Parteizentrale sich seit 1925 in der Schellingstraße befunden hatte. Nach Entwürfen Hitlers leitete der Architekt Paul Ludwig Troost den Umbau, und Anfang 1931 richtete sich die Reichsleitung der NSDAP im »Braunen Haus« ein.
Thomas Manns Schwiegereltern Hedwig und Alfred Pringsheim, die ihr 1889/90 gebautes großbürgerliches Stadthaus an der Arcisstraße 12 (heute: Katharina-von-Bora-Straße 10) bewohnten, wurden im August 1933 gezwungen, ihr Heim zu verlassen. Die Nationalsozialisten rissen es im November 1933 ab, um Platz für einen Verwaltungsbau der NSDAP zu schaffen, der bis 1937 von Paul Ludwig Troost errichtet wurde. Im selben Jahr stellte Paul Ludwig Troost mit seinem Atelier auch den »Führerbau« fertig (heute: Arcisstraße 12).
Paul Ludwig Troost drehte die Blickrichtung auf dem »Königlichen Platz« in München um 180 Grad, indem er am östlichen Rand, zu beiden Seiten der Brienner Straße, zwei »Ehrentempel« für die Sarkophage der beim Münchner Putschversuch 1923 umgekommenen »Blutzeugen« errichtete. Die »ewige Wache« wurde am 9. November 1935 eingeweiht. Außerdem entfernte der Architekt die Grünanlagen und ließ 20.000 Granitplatten verlegen. (Weil sich bei Platzregen das Wasser darauf sammelte, sprach man heimlich vom »Plattensee«.)
Als Anfang 1934 die Landtage aufgehoben wurden, existierte Bayern zwar ebenso wie die anderen Länder weiter, aber als untergeordnete Verwaltungseinheit.
Hitler bezeichnete München in einer Rede bei der Grundsteinlegung des »Hauses der Deutschen Kunst« im Frühjahr 1933 als »Hauptstadt der Deutschen Kunst«, im Jahr darauf sprach er von der »Hauptstadt der Kunst und unserer Bewegung«, und 1935 stimmte Hitler dem Vorschlag des Münchner Oberbürgermeisters Karl Fiehler zu, München offiziell den Titel »Hauptstadt der Bewegung« zu verleihen.
Als Ersatz für den 1931 abgebrannten Glaspalast im → Alten Botanischen Garten baute Leonhard Gall 1933 bis 1937 nach Hitlers Vorgaben und Plänen des Architekten Paul Ludwig Troost das »Haus der Deutschen Kunst« in der Prinzregentenstraße, das den Englischen Garten noch stärker vom → Hofgarten und Finanzgarten (heute: → Dichtergarten) abriegelte. Eröffnet wurde es im Juli 1937 mit der Großen Deutschen Kunstausstellung. Parallel dazu veranstaltete Adolf Ziegler, der Präsident der Reichskammer der bildenden Künste, in den 1780/81 von Carl Albert von Lespilliez (1723 ‒ 1796) gebauten nördlichen Hofgartenarkaden die Ausstellung »Entartete Kunst«, die dann als Wanderausstellung reichsweit zu sehen war. (Es war übrigens nicht die erste »Schandausstellung« dieser Art.) Nach dem Beispiel der Bücherverbrennung organisierte der Reichspropagandaminister Joseph Goebbels nun die Ausgrenzung in der bildenden Kunst: Was nicht dem Schönheitsideal der Nationalsozialisten entsprach – Expressionismus, Surrealismus, Kubismus und vieles mehr – wurde als Verfallserscheinung diffamiert, ebenso wie alle Werke jüdischer Künstlerinnen und Künstler.
1828 bis 1831 war für Herzog Max Joseph, einen Schwager des Königs Ludwig I., ein Palais in der Ludwigstraße nach Entwürfen des Architekten Leo von Klenze gebaut worden. Dort kam am 24. Dezember 1837 Prinzessin Elisabeth zur Welt, die spätere Kaiserin von Österreich (»Sisi«). 1937 ließ der Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht das klassizistische Herzog-Max-Palais abreißen, um Platz für einen Neubau der Reichsbank zu schaffen. Der Architekt Heinrich Wolff begann zwar 1938 damit, aber fertiggestellt wurde das Bauwerk erst 1951 von Carl Sattler für die Bundesbank.
1938 erzwangen die Nationalsozialisten die Eingemeindung von Solln, Großhadern, Pasing, Obermenzing, Untermenzing, Allach, Ludwigsfeld und Feldmoching in die »Hauptstadt der Bewegung«, und am 1. Mai 1938 wurden Hitlers gigantomanische Baupläne für München bekanntgegeben. Dazu gehörten eine U-Bahn, ein Autobahnring, Aufmarschplätze, Theater und eine von gigantischen Marmorpalästen gesäumte sechs Kilometer lange und 125 Meter breite Prachtstraße von der Altstadt zum neuen Hauptbahnhof in Laim mit einer fast 200 Meter hohen »Säule der Bewegung«. Die 1827 bis 1833 gebaute → Matthäuskirche in der Sonnenstraße wurde 1938 abgerissen, weil sie den Bauplänen im Weg stand. Aber weder die U-Bahn noch die Verlegung des Hauptbahnhofs oder den Prachtboulevard nach Laim verwirklichten Hitler und sein Münchner »Generalbaurat« Hermann Giesler. Luftschloss blieb auch ein Ensemble auf dem Gelände der Türkenkaserne und des Wittelsbacher Palais mit einem »Platz der NSDAP«, einem »Haus der Arbeit«, einer monströsen »Halle der Partei« und einem Mausoleum für Hitler nach dem Vorbild des Pantheons in Rom.
Fast gleichzeitig mit der Matthäus-Kirche wurde die 1883 bis 1887 vom Architekten Albert Schmidt im Auftrag König Ludwigs II. errichtete Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße auf persönlichen Befehl Hitlers im Sommer 1938 abgerissen – also noch vor der Reichspogromnacht im November 1938.
Der Bildhauer Herbert Peters schuf 1969 einen Mahnmal in der Herzog-Max-Straße,
das die Erinnerung an die Alte Hauptsynagoge und die Verbrechen der Nationalsozialisten wach hält.
Der nationalsozialistische Münchner Oberbürgermeister Karl Fiehler hatte bereits im März 1933 verfügt, dass jüdischen Betrieben alle städtischen Aufträge entzogen wurden. Die reichsweite Entrechtung der Juden beispielsweise durch die Nürnberger Gesetze von 1935 kam dazu. Nach einem Gedenkmarsch am 9. November 1938 in München für den (gescheiterten) Hitlerputsch von 1923 rief der Reichspropagandaminister Joseph Goebbels im Alten Rathaus dazu auf, das zwei Tage zuvor in Paris verübte Attentat des Juden Herschel Grynszpan auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath zu rächen. Kurz darauf traf die Nachricht ein, dass Ernst vom Rath den Schussverletzungen erlegen sei. Noch in derselben Nacht kam es zu einem verheerenden Judenpogrom. (Die Bezeichnung »Reichskristallnacht« gilt seit den Achtzigerjahren als unkorrekt.)
In einem »arisierten« – also enteigneten – Anwesen an der Widenmayerstraße 27 richtete sich die »Vermögensverwertung München GmbH« ein, um das den Münchner Juden geraubte Eigentum Nationalsozialisten oder deren Sympathisanten zuzuschieben. Als Gesellschafter fungierte der Gauleiter Adolf Wagner. Wann er die zum Netzwerk der »Arisierungsstelle« bei der NSDAP-Gauleitung und der Finanzverwaltung gehörende Tarnfirma gegründet hatte, lässt sich nicht mehr ermitteln.
Widenmayerstraße 27
Der städtische Siedlungsreferent Guido Harbers (1897 – 1977) baute mit einer Reihe weiterer Architekten für die »Deutsche Siedlungsausstellung München 1934« die → »Mustersiedlung Ramersdorf« aus 192 Häusern. Allerdings blieb die erstrebte Vorbildfunktion aus, denn Gärten zur Erholung statt zur Selbstversorgung entsprachen nicht den nationalsozialistischen Vorstellungen.
1936 bis 1939 realisierte Guido Harbers mit der von ihm wiederbelebten »Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsstättengesellschaft« eine Siedlung in Berg am Laim nach Vorstellungen von Karl Preis (»Maikäfersiedlung«). Dabei ging es um mehr als 600 kostengünstige »Volkswohnungen« zur Bekämpfung der Wohnungsnot in München. Für eine Familie mit zwei Kindern sahen Karl Preis und Guido Harbers gerade einmal 35 m² Wohnfläche vor. Statt teurer Ziegel verwendete man »Iporit«, einen neuartigen Kunststein aus Schaumbeton. Dass dieser Werkstoff im Lauf der Zeit unter Feuchtigkeitseinwirkung seine Druckfestigkeit verliert, stellte sich erst später heraus.
Um den von Hitler angestrebten Krieg zu verhindern, schlossen die Regierungschefs von Italien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich, Benito Mussolini, Édouard Daladier und Neville Chamberlain in der Nacht vom 29./30. September 1938 mit Hitler im »Führerbau« (siehe oben) das »Münchner Abkommen«. Damit beschlossen sie, dass die – in München gar nicht vertretene – Tschechoslowakei das Sudetenland an Deutschland abzutreten und binnen zehn Tagen zu räumen habe.
Hitler ärgerte sich über die Appeasement-Politik Neville Chamberlains, die ihn daran hinderte, sofort mit Krieg zu beginnen. Aber lang hielt er nicht still: Mitte März 1939 brach er das Münchner Abkommen und ließ die »Rest-Tschechei« militärisch besetzen. Am 1. September 1939 überfiel er Polen. Damit löste er den Zweiten Weltkrieg aus.
Im Oktober 1939 wurde der von Ernst Sagebiel in zwei Jahren gebaute Flughafen München-Riem eröffnet. Er galt damals als modernster Flughafen der Welt. Die Geschichte der Luftfahrt in Bayern hatte im März 1919 begonnen, als eine Rumpler Ru C IV von Berlin über Gotha und Augsburg nach München geflogen war, wo seit 1910 ein zunächst nur für militärische Zwecke benütztes Flugfeld auf dem Exerzierplatz Oberwiesenfeld zur Verfügung stand.
Der Schreiner Georg Elser hatte von Dezember 1936 bis März 1939 als Hilfsarbeiter in einem Unternehmen in Heidenheim gearbeitet und die Gelegenheit genutzt, um nach und nach 250 Pressstücke Schießpulver zu entwenden. Im Frühjahr 1939 wechselte er für kurze Zeit zu einem Steinbruch in Königsbronn-Itzelberg und stahl dort 125 Sprengkapseln sowie 105 Dynamit-Sprengpatronen. Dann zog er nach München und bereitete sich weiter auf einen Anschlag gegen Hitler vor. Im September und Oktober 1939 aß er abends im Bürgerbräukeller, versteckte sich, bis geschlossen wurde und höhlte nachts eine Säule aus, damit er schließlich seine tagsüber gebaute Zeitbombe platzieren konnte.
Am 8. November 1939 war – wie üblich – eine Rede Hitlers im Bürgerbräukeller anlässlich des am 8./9. November 1923 gescheiterten Putschversuchs geplant. Georg Elser stellte den Zeitzünder auf 21.20 Uhr ein. Weil Hitler jedoch wegen schlechten Wetters für die Rückreise nach Berlin statt des Flugzeugs den Zug nehmen musste, begann er schon um 20 Uhr mit seiner einstündigen Rede und war bereits unterwegs zum Bahnhof, als die Bombe in der Säule hinter dem Rednerpult explodierte. Acht Menschen wurden getötet und 15 schwer verletzt.
Noch am Abend wurde Georg Elser beim Versuch, in die Schweiz zu entkommen, in Konstanz festgenommen. Ohne Gerichtsverfahren sperrten ihn die Nationalsozialisten ein und erschossen ihn am 9. April 1945 im KZ Dachau.


Dort befindet sich seit 2009 eine Installation der Künstlerin Silke Wagner mit dem Titel »8. November 1939«.
Loomit und Won ABC schufen 2017 das 22 Meter hohe Mural in der Bayerstraße zu Ehren von Georg Elser.
Im Juni 1940 fanden die ersten Bombenangriffe der Royal Air Force und der Armée de l’air auf München statt. Ziel war vor allem das BMW-Flugmotorenwerk in Allach.
1941 richteten die Nationalsozialisten ein Barackenlager an der Ecke Knorrstraße / Troppauer Straße für jüdische Zwangsarbeiter ein (»Judensiedlung Milbertshofen), das auch als Durchgangslager für Deportationen nach Theresienstadt, Piaski und Auschwitz diente. Im April 1942, vier Monate vor der Auflösung des Lagers in Milbertshofen, wurde der jüdische Unternehmer Curt Mezger als Lagerleiter eingesetzt. Er leitete dann auch das Sammellager in Berg am Laim, bis es Anfang März 1943 geräumt wurde. Curt Mezger starb 1945 im KZ Ebensee, einem Außenlager des KZ Mauthausen.
Vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten hatten 12.000 Judinnen und Juden in München gelebt. Das NS-Regime entrechtete und drangsalierte, enteignete und vertrieb sie. Schätzungsweise 3000 von ihnen wurden unter dem NS-Regime deportiert und zumeist ermordet. Am 30. April 1945 fanden die Amerikaner nur noch 84 Jüdinnen und Juden in München vor.

Ein von Robert Lippl gestaltetes Mahnmal erinnert seit 1982 in Milbertshofen an das damalige Sammellager.
Walter Klingenbeck (1924 – 1943) gehörte der katholischen Jungschar St. Ludwig in München an, bis die Nationalsozialisten sie verboten. Dadurch begann er das NS-Regime kritisch zu sehen. Als Lehrling freundete sich Walter Klingenbeck mit Erwin Eidel, Johann Haberl und Daniel von Recklinghausen an. Die vier Jugendlichen, die sich alle in einer Ausbildung befanden, hörten verbotenerweise Radio Vatikan und deutschsprachige Sendungen sowohl der BBC als auch des britischen Propagandasenders »Gustav Siegfried 1«. 1941 folgte Walter Klingenbeck dem Aufruf der BBC, das V für Victory als Hoffnung auf den Sieg der Alliierten zu verbreiten und malte in Bogenhausen ein paar Dutzend Vs an Hauswände. Daniel von Recklinghausen stand dabei Schmiere. Eine Bekannte, der Walter Klingenbeck von der Aktion berichtete, denunzierte ihn. Der Siebzehnjährige und seine drei Freunde wurden daraufhin im Januar 1942 verhaftet und am 24. September vom Volksgerichtshof im großen Schwurgerichtssaal des Münchner Justizpalastes verurteilt: Erwin Eidel zu acht Jahren Zuchthaus, seine drei Mitverschwörer zum Tod. Im August 1943 verwandelte man die Todesstrafen für Johann Haberl und Daniel von Recklinghausen in Haftstrafen, aber Walter Klingenbeck starb am 5. August 1943 in München-Stadelheim unter dem Fallbeil. Der Walter-Klingenbeck-Weg zwischen der Bayerischen Staatsbibliothek und der → Ludwigskirche erinnert an ihn.
Die Kommilitonen Hans Scholl und Alexander Schmorell, die an der Ludwig-Maximilians-Universität München Medizin studierten, verschickten im Sommer 1942 Flugblätter unter dem Absender »Weiße Rose«, um zum Widerstand gegen das NS-Regime aufzurufen.
Nachdem Hans Scholl und Alexander Schmorell von einem mehrmonatigen Einsatz als Sanitäter an der Ostfront nach München zurückgekommen waren, verteilten sie einige tausend Exemplare eines fünften Flugblatts. Zum inneren Kern der »Weißen Rose« gehörten zu diesem Zeitpunkt auch Hans Scholls jüngere Schwester Sophie Scholl, die in München Biologie und Philosophie studierte, die Medizinstudenten Christoph Probst und Willi Graf sowie der Philosophieprofessor Kurt Huber.
Am Morgen des 18. Februar 1943 beobachtete der Hausmeister der Universität, wie die Geschwister Scholl das sechste Flugblatt der »Weißen Rose« auslegten ‒ und sorgte dafür, dass sie von der Gestapo festgenommen wurden.
Hans und Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Kurt Huber, Willi Graf und andere Mitglieder der »Weißen Rose« starben für ihre Überzeugung, gegen ein nicht zuletzt von Mitläufern und Duckmäusern ermöglichtes Terrorregime die Stimme erheben zu müssen.
Lothar Dietz: Mahnmal »Weiße Rose« (LMU)
Nikolai Tregor jr.: Sophie Scholl (LMU)
Christine Stadler: Geschwister Scholl (Katholische Akademie)


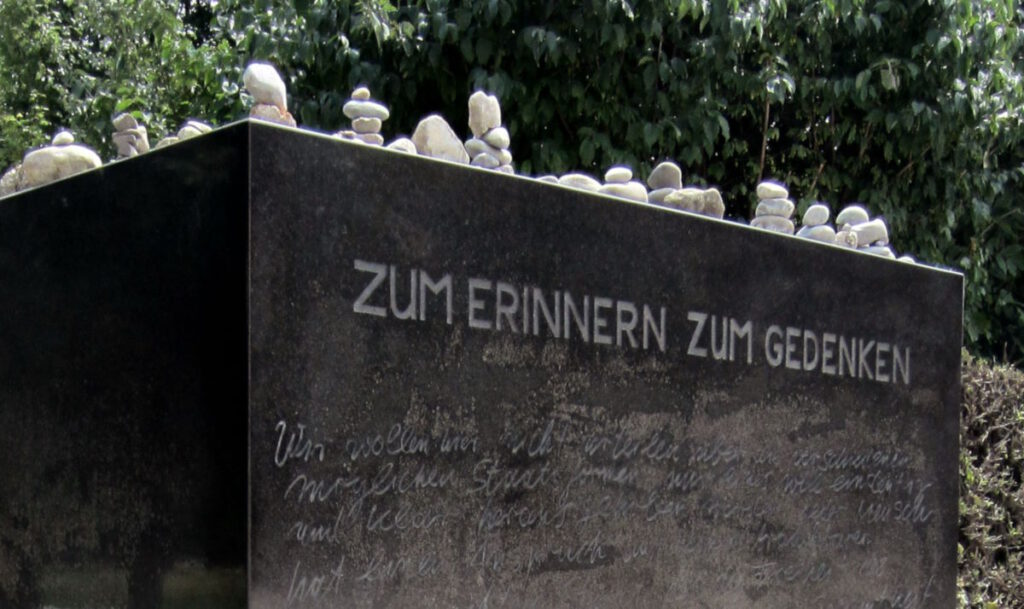

München Stadtgeschichte 1945 ‒ 1972
»Stunde Null« und Nachkriegszeit
Eine von Hauptmann Rupprecht Gerngroß, dem Chef einer Dolmetscherkompanie in München, angeführte Gruppe, plante Ende April 1945, München und Oberbayern kampflos den US-Streitkräften zu übergeben, um sinnloses Blutvergießen zu verhindern. In der Nacht vom 27./28. April 1945 besetzte die »Freiheitsaktion Bayern« Rundfunksender in Erding und Freimann, und Rupprecht Gerngroß rief übers Radio die Soldaten dazu auf, die Waffen niederzulegen. Paul Giesler, seit 1942 Gauleiter von München-Oberbayern und bayrischer Ministerpräsident, seit April 1945 auch »Reichsverteidigungskommissar Süd«, schlug die Freiheitsaktion Bayern in kurzer Zeit mit SS-Einheiten nieder und ließ Beteiligte wie Günther Caracciola-Delbrück, Harald Dohrn, Hans Quecke, Maximilian Roth und Hans Scharrer am 28. bzw. 29. April 1945 im Innenhof des Zentralministeriums (heute: Landwirtschaftsministeriums) an der Ludwigstraße standrechtlich erschießen. Rupprecht Gerngroß konnte fliehen. 1947 benannte man den ehemaligen Feilitzschplatz in Schwabing, den die Nationalsozialisten 1933 in »Danziger Freiheit« umgetauft hatten, in »Münchener Freiheit« um, und seit 1998 heißt der Platz offiziell Münchner Freiheit.
Zum Konzentrationslager Dachau stießen die Amerikaner am 29. April vor; München erreichten sie am Tag danach. Nahezu kampflos nahmen die US-Truppen die »Hauptstadt der Bewegung« ein. In der Nacht davor waren noch 650 Gemälde aus dem »Führerbau« gestohlen worden. Am 1. Mai 1945 etablierten die Amerikaner im Neuen Rathaus eine Militärregierung unter dem »Commanding Officer« Colonel Eugene Keller. Der kommissarisch als Oberbürgermeister eingesetzte Verlagsleiter Franz Stadelmayer übergab das Amt am 4. Mai Karl Scharnagl. Der gehörte dann im Oktober 1945 auch zu den Gründern der CSU. Und die verfehlte bei der ersten Stadtratswahl im Mai 1946 mit 20 von 41 Sitzen nur knapp die absolute Mehrheit.
Der Freistaat Bayern existierte seit dem »Gesetz über den Neuaufbau des Deutschen Reiches« vom Januar 1934 nicht mehr, bis die US-Militärregierung im September 1945 das Land Bayern neu gründete – allerdings ohne die bayrische Pfalz, die 1946 in Rheinland-Pfalz aufging.
In der → Großen Aula der → Ludwig-Maximilians-Universität München tagte die am 30. Juni 1946 gewählte Verfassunggebende Landesversammlung, und am 1. Dezember 1946 bestätigte die bayrische Bevölkerung die von Staatsrechtsprofessor Hans Nawiasky entworfene und von der Landesversammlung vorgelegte Verfassung des Freistaats Bayern.
Bei den am selben Tag durchgeführten Landtagswahlen erzielte die CSU die absolute Mehrheit (52,3 %), und Hans Ehard wurde zum Ministerpräsidenten gewählt. Das Parlament tagte zunächst ebenfalls in der Großen Aula der Universität, ab Ende Mai 1947 dann im Sophiensaal im Gebäude der damaligen Oberfinanzdirektion München – und ab Januar 1949 im → Maximilaneum.
Frankreich, das Vereinigte Königreich und die USA, Belgien, die Niederlande und Luxemburg forderten im Schlusskommuniqué ihrer Londoner Konferenz die Deutschen in den drei westlichen Besatzungszonen im Juni 1948 auf, einen föderalen Staat aufzubauen. Vom 10. bis 23. August 1948 fand auf der Insel Herrenchiemsee ein Verfassungskonvent statt. Und der von September 1948 bis Mai 1949 in Bonn tagende Parlamentarische Rat erarbeitete das Grundgesetz, das dann von allen Landtagen in den drei westlichen Besatzungszonen mit Ausnahme von Bayern ratifiziert wurde. Ministerpräsident Hans Ehard hätte sich eine noch stärkere Ausprägung des föderalen Prinzips gewünscht und meinte deshalb: »Nein zum Grundgesetz, ja zu Deutschland.« Immerhin akzeptierte der Freistaat Bayern trotz der Ablehnung die Rechtsverbindlichkeit des Grundgesetzes, und am 23. Mai 1949 trat es in Kraft.
Die beiden »Ehrentempel« der Nationalsozialisten am Königsplatz wurden 1947 gesprengt. Den benachbarten »Führerbau« in der Arcisstraße nutzte zunächst die US-Militärregierung. 1957 zog die Hochschule für Musik und Theater München dort ein. Die Ruine des kriegszerstörten »Braunen Hauses« riss man 1947 ab, und das Areal blieb zunächst unbebaut. Erst 2012 bis 2015 wurde dort das NS-Dokumentationszentrum errichtet (NS-Dokumentationszentrum München ‒ Lern- und Erinnerungsort zur Geschichte des Nationalsozialismus, Max-Mannheimer-Platz 1).
NS-Dokumentationszentrum
Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten mehr als 800.000 Menschen in München gelebt. Obwohl mehr als die Hälfte der in München Wohnenden vor den Bomben aufs Land geflüchtet waren, hatten 6700 Menschen in München bei den Luftangriffen ihr Leben verloren. 22.350 Münchner waren im Krieg gefallen; viele befanden sich in Kriegsgefangenschaft. Die Einwohnerzahl betrug bei Kriegsende weniger als 480.000. Allerdings wuchs sie bis Ende 1945 durch Kriegsheimkehrer und Geflüchtete wieder auf gut 625.000 an (Anna Kurzhals, S. 62).
Die Hälfte der Bausubstanz in München war durch den Krieg zerstört. In der Innenstadt und in einzelnen Stadtteilen war es noch weit mehr. 60.000 bis 80.000 Wohnungen waren kaputt, 300.000 Menschen obdachlos. Statt der historischen Bauwerke prägten Ruinen das Stadtbild. 7 Millionen Kubikmeter Schutt galt es zu beseitigen. Legendär war der Einsatz von »Trümmerfrauen« bei der Schuttbeseitigung. Oberbürgermeister Thomas Wimmer (SPD), der im Mai 1948 Karl Scharnagl (CSU) abgelöst hatte, rief: »Rama dama!« 7500 Menschen folgten dem Ruf zum Beispiel am 29. Oktober 1949 und arbeiteten den ganzen Tag für eine von Bäckern, Metzgern und Wirten gestiftete Brotzeit. Schuttberge entstanden auf dem Oberwiesenfeld (→ Olympiaberg), im → Luitpoldpark (Luitpoldhügel) und in Sendling (→ Neuhofener Berg).

Album über den Olympiapark
Gerade einmal 2,5 Prozent der Wohnungen waren unbeschädigt. Die Wohnungsnot verschärfte sich, weil Evakuierte nach München zurückkehrten und befreite KZ-Häftlinge, ehemalige Zwangsarbeiter und Heimatvertriebene ebenso ein Dach über dem Kopf benötigten wie die Angehörigen der Besatzungsmacht.
Die Menschen litten nicht nur unter der Wohnungsnot, sondern auch unter der katastrophalen Versorgungslage. Die Preise auf dem Schwarzmarkt zum Beispiel in der Möhlstraße in Bogenhausen konnten sich nicht alle leisten. Viele Stadtbewohner fuhren mit dem Fahrrad oder Zug aufs Land, um verbotenerweise zu »hamstern«, das heißt Hausrat und Wertgegenstände gegen Kartoffeln, Speck und Eier zu tauschen. Aus Wolldecken schneiderte man Mäntel, aus Anzügen Gefallener Damenjacken (»Behelfsmode«). Und Damen, die sich keine Nylonstrümpfe leisten konnten, malten sich eine »Naht« aufs nackte Bein.
Die beispielsweise vom Architekten Bodo Ohly vertretene Idee, das zerstörte München am Starnberger See neu zu bauen, wurde rasch verworfen.
1954 fand die Grundsteinlegung für die erste größere Wohnsiedlung in München nach dem Zweiten Weltkrieg statt: die Parkstadt Bogenhausen. Franz Ruf war für den Bebauungsplan verantwortlich, Alfred Reich für die Gestaltung der Grünanlagen. Architekten wie Hans Knapp-Schachleiter, Johannes Ludwig, Johann Christoph Ottow, Matthä Schmölz und Hellmuth von Werz planten die verschiedenen Gebäude. Die »Neue Heimat Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft« ließ 1955/56 zwischen der Richard-Strauß-Straße und der Gotthelfstraße, dem Schreberweg und der Stuntzstraße 2000 Wohnungen für 6000 Menschen bauen, dazu Läden, Kindergärten und Schulen. Der Komfort war für damalige Verhältnisse hoch. Beispielsweise sind alle der zwischen 26 und 80 m² großen Wohnungen mit einer Zentralheizung ausgestattet, die anfangs mit einem Ölheizwerk betrieben wurde und inzwischen ans Fernwärme-Netz angeschlossen ist.
Die zentrale Straße in der Parkstadt Bogenhausen wurde 1955 nach dem Juristen und Volkswirtschaftler Paul Busching (1877 – 1945) benannt, der 1899 in München einen Verein für Verbesserung der Wohnverhältnisse (heute: Gemeinnütziger Wohnungsverein München 1899 e. V.) gegründet hatte. Das Denkmal für Paul Busching in der Buschingstraße stellt einen Grundsteinleger dar und wurde 1958 vom Bildhauer Seff Weidl (1915 – 1972) gestaltet.
Die zentrale Frage beim Wiederaufbau lautete: Neubauten oder historisierende Rekonstruktionen? »Wir wollen nicht die Städte unserer Großväter, sondern die unserer Kinder bauen«, meinte der Schweizer Architekt Max Bill. Karl Meitinger, der 1938 Münchner Stadtbaurat geworden war, wurde von den Amerikanern in diesem Amt reaktiviert. 1946 stellte er »Vorschläge zum Wiederaufbau« der Stadt München zur Diskussion (»Meitinger-Plan«). Wo ausreichend Bausubstanz erhalten war, schlug er Rekonstruktionen vor, aber völlig zerstörte Gebäude sollten frei gestaltet werden ‒ oder unbebaut bleiben, um Platz für Heimgärten zur Aufbesserung der Ernährungsbasis zu schaffen. Zur Entlastung des Autoverkehrs im Stadtzentrum konzipierte Karl Meitinger zwar einen breiten Altstadtring und zwei weitere Ringstraßen, aber er lehnte es ab, die zertrümmerte Altstadt »autogerecht« neu zu gestalten.
Bereits im Februar 1946 wurde der »Kulturbaufonds München« gegründet, ein Verein, der Spenden für den Wiederaufbau der zerstörten Stadt und ihrer Kunst- und Kulturdenkmäler sammelte.
Die Ruine des Alten Peter sollte nach dem Krieg zunächst gesprengt werden, aber 1946 bis 1954 baute man die älteste Pfarrkirche Münchens dann doch wieder auf. Die Rekonstruktion des Inneren dauerte bis 2000, bis Hermenegild Peiker die Deckenfresken von St. Peter erneuerte.
Alter Peter in München
Album über den Alten Peter
Das Nationaltheater war durch einen Luftangriff 1943 zerstört worden. Nach dem Krieg wurde über einen modernen Neubau diskutiert, aber die Befürworter einer Rekonstruktion setzten sich durch: 1958 bis 1963 leiteten Gerhard Moritz Graubner und Karl Fischer den Wiederaufbau. Von 1945 bis zur Fertigstellung diente das Prinzregententheater als Opernbühne.
Album übers Bayerische Nationaltheater / Album über Theatergeschichte
Um die kriegszerstörte Münchner Residenz wiederaufzubauen, wurde schon im Mai 1945 ein Baubüro eingerichtet. Dessen Leitung übernahm 1953 Otto Meitinger, ein Sohn des früheren Stadtbaurats Karl Meitinger. Im selben Jahr wurde der Herkulessaal anstelle des Thronsaals von König Ludwig I. fertiggestellt. Aber erst mit der Wiedereröffnung der → Allerheiligen-Hofkirche waren die Arbeiten 2003 abgeschlossen.
Alben: Residenz, Residenz-Museum, Schatzkammer
»Die zweite Zerstörung Münchens« lautet der Titel eines 1978 vom Architekten Erwin Schleich* (1925 – 1992) veröffentlichten Buches. Die erste Zerstörung geschah durch die Nationalsozialisten und den Zweiten Weltkrieg. Aber auch in den Fünfziger- und Sechzigerjahren wurden seiner Meinung nach schwere Bausünden begangen, indem erhaltenswerte Fassaden, Palais und historische Bauwerke unnötig abgerissen wurden. Dazu kamen »maßlose Straßenschneisen, monströse Verkehrsbauwerke, Flächenabbrüche – Altstadtring Nord-Ost, Prinz-Carl-Palais-Tunnel, Isarparallele West an der Bogenhauser Brücke«.
Das 1912 von Heilmann & Littmann im Zopfstil gebaute Roman-Mayr-Haus, ein Textilgeschäft an der Südwestecke des Marienplatzes, wurde zwar im Zweiten Weltkrieg beschädigt, aber man hätte es restaurieren können. Stattdessen wurde es 1969 abgerissen, um Platz für einen Neubau des Architekten Josef Wiedemann* zu schaffen. Seit 1972 steht nun statt des Roman-Mayr-Hauses ein mit Granitplatten verkleideter Betonklotz (»Warenfestung«) am Marienplatz, und darin sehen zumindest die Traditionalisten eine der schlimmsten Bausünden der Nachkriegszeit.
*) Mehr zu Erwin Schleich und Josef Wiedemann im Album über Architekten

Als Bausünde galt auch das 1964 nach Entwürfen des Architekten Franz Hart (1910 – 1996) errichtete 50 Meter hohe Hertie-Hochhaus an der Münchener Freiheit (seit 1998: Münchner Freiheit), denn bereits vom → Siegestor aus sah man den schwarzen Kasten über der Leopoldstraße aufragen. 1992 wurde der »Schwarze Riese« abgerissen.
Als erste nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayern wieder zugelassene Zeitung erschien am 6. Oktober 1945 die Süddeutsche Zeitung. Die ersten Druckplatten entstanden aus dem Bleisatz von Hitlers Buch »Mein Kampf«.
Die Münchner »Abendzeitung« brachte am 2. Dezember 1949 die erste Kolumne von »Blasius, dem Spaziergänger«. Jahrzehntelang protokollierte Blasius, was er bei seinen Spaziergängen in der bayrischen Landeshauptstadt beobachtete. Verfasser der verschmitzten Texte war Sigi Sommer, und Ernst Hürlimann lieferte die originellen Strichzeichnungen dazu.


links: Sendlinger Straße (Foto: 2024) / rechts: Rosenstraße (Foto: 2014)
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Wiederaufbau der Städtischen Bibliotheken, von deren Buchbestand 40 Prozent zerstört worden war. Hans Ludwig Held (1885 – 1954), den die Nationalsozialisten 1933 entlassen hatten, übernahm im Mai 1945 erneut die Leitung der Bibliothek – bis zu seiner Pensionierung 1953.
Bei der Münchner Stadtbibliothek mit 25 Stadtteilbibliotheken handelt es sich um das größte kommunale Bibliothekssystem in Deutschland. Die philatelistische Spezialbibliothek, deren Grundstock 1931 die Buchbestände des Münchner Briefmarken-Club gebildet hatten, ist die bedeutendste in Europa.
Seit 1977 befindet sich die »Monacensia« (Münchnerisches) im → Hildebrandhaus in Bogenhausen. Die zur Stadtbibliothek gehörende Einrichtung sammelt Autorennachlässe für das Literaturarchiv und verfügt über eine Forschungsbibliothek zur Geschichte und Kultur Münchens. Gegründet hatte sie Hans Ludwig Held 1922, ein Jahr nachdem er Leiter der Volks- und der Magistratsbibliothek geworden war. 1924 hatte er eine Handschriftensammlung hinzugefügt.


Mehr zur Monacensia und zum Hildebrandhaus im Album über Bogenhausen
Zu heftigen Straßenkämpfen zwischen Jugendlichen und Polizei kam es am 21. Juni 1962 in Schwabing. Gegen Mitternacht versuchten Polizisten, das Gitarrenspiel von Straßenmusikern zu beenden. Umstehende hinderten sie daran. Als die Polizei mit einer Hundertschaft anrückte, eskalierte die Lage. Die Polizisten schlugen mit dem Gummiknüppel zu, die Demonstranten verbarrikadierten sich hinter umgestürzten Autos, warfen mit Steinen und Flaschen. Fünf Nächte lang hielten die »Schwabinger Krawalle« an. Dutzende von Menschen wurden verletzt, vierzehn davon schwer. Das zwang die Polizei zum Umdenken, und sie entwickelte daraufhin neue deeskalierende Vorgehensweisen (»Münchner Linie«).
Die antiautoritären Schwabinger Krawalle waren Symptome eines Generationenkonflikts, der sich dann in der Bundesrepublik zur gesellschaftskritischen Studentenbewegung (»Unter den Talaren: Muff von 1000 Jahren«) und »Außerparlamentarischen Opposition« (APO) entwickelte. Diese gehörten wiederum in den Kontext einer in den westlichen Ländern verbreiteten Bewegung nicht nur speziell gegen den Vietnam-Krieg, sondern generell für Freiheit und Selbstbestimmung. Die »sexuelle Revolution«, die mit dieser »68er-Bewegung« einherging, wurde durch die ab Anfang der Sechzigerjahre verfügbare Antibaby-Pille begünstigt (»Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment«).
München Stadtgeschichte 1972
1972: Olympiastadt München
Für die Münchner Oberbürgermeister Karl Scharnagl und Thomas Wimmer war es um den Wiederaufbau und die Verbesserung der Lebensbedingungen gegangen. Erst Hans-Jochen Vogel arbeitete gezielt am Marketing für München und sorgte bereits in seinem ersten Amtsjahr für die Einrichtung eines eigenständigen Fremdenverkehrsamts. Seine zwölfjährige Amtsperiode (1960 – 1972) brachte der Landeshauptstadt nicht nur einen Modernisierungsschub, sondern auch einen Imagegewinn. 1962 begann München mit dem von Dorit Lilowa bei einem Ideenwettbewerb vorgeschlagenen Slogan »Weltstadt mit Herz« zu werben.
Das »Time Magazine« porträtierte München Ende Februar 1964 als »Germany’s young city« und hob nicht nur das Wirtschaftswachstum hervor, sondern auch das Kulturleben. München verfüge über doppelt so viele Sitzplätze in Theatern und Konzertsälen wie Berlin, hieß es – »and usually they are filled«.
München galt schon lange als Kunstmetropole. Nun präsentierte sich die Landeshauptstadt darüber hinaus auch als »Wirtschaftsmetropole mit unsichtbarer Industrie« (Anna Kurzhals, S. 248).
Trotz des Bevölkerungswachstums reduzierte sich die Zahl der Bewohner der Altstadt dramatisch. Eine City mit Büros, Geschäften und Gastronomie bildete sich. Da die Beschäftigten nicht mehr in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen konnten, schwoll der Berufsverkehr an. Die bayrische Landeshauptstadt drohte im Verkehr zu ersticken, und der Straßenbau allein konnte nicht die Lösung bringen.
In dieser Lage hörte Hans-Jochen Vogel auf den NOK-Präsidenten Willi Daume, setzte sich Mitte der Sechzigerjahre für eine Bewerbung der Stadt als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 1972 ein – und erreichte damit vieles zugleich. Beginnen wir mit dem Verkehr.
Von 1954 an diskutierten die Deutsche Bundesbahn und die Landeshauptstadt München Konzepte für den öffentlichen Personennahverkehr. Die Bahn wollte einen Tunnel zwischen Haupt- und Ostbahnhof bauen, um ihre westlichen und östlichen Vorortsstrecken zu verbinden, aber darauf ließ sich der Magistrat zunächst nicht ein. Erst 1963 gab man nach und einigte sich mit der Bahn auf ein gemeinsames Verkehrssystem. Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) wurde 1971 durch ein Vertragswerk gegründet. Zweck des MVV ist es, die verschiedene öffentlichen Verkehrsmittel zu bündeln und Reisenden ‒ besonders Pendlern ‒ im Großraum München durch die Zusammenarbeit der Stadt und der beteiligen Landkreise, der Bahn und des Freistaats Bayern ein einheitliches Netz mit aufeinander abgestimmten Fahrplänen zu bieten, für das konsequenterweise auch nur ein gemeinsamer Fahrschein benötigt wird.
1964/65 beschloss der Stadtrat den Bau zunächst einer in Nord-Süd-Richtung verlaufenden U-Bahn-Strecke, und 1965 löste der bayrische Ministerpräsident Alfons Goppel in der Ungererstraße auf Höhe des → Nordfriedhofs symbolisch den ersten Rammstoß für den U-Bahn-Bau aus. Zwei Jahre später begann der Bau des S-Bahn-Tunnels (»Stammstrecke«).
Der 1938 in der Lindwurmstraße begonnene Bau einer Tunnelstrecke zwischen → Harras und Freimann war 1941 wegen des Krieges eingestellt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg züchtete man in dem 590 Meter langen, teilweise zugeschütteten Tunnel Champignons, bis die Stadt ihn der Bahn abkaufte und 1965 frei sprengen ließ.
Als das IOC 1966 die XX. Olympischen Sommerspiele nach München vergab, erhielt das Projekt weiteren Auftrieb. Schon im Jahr darauf konnten die ersten Testfahrten mit U-Bahn-Prototypen zwischen den Stationen → Alte Heide und → Studentenstadt stattfinden. Rechtzeitig vor den Olympischen Spielen 1972 in München nahmen U- und S-Bahnlinien den Betrieb auf.


Der Architekt Alexander Freiherr von Branca war sowohl für den Bau (1966 bis 1971) als auch den Um- bzw. Ausbau (2003 bis 2006) des U- und S-Bahnhofs Marienplatz verantwortlich. Als einziger der 1971 in Betrieb genommenen U-Bahnhöfe weicht dieser von dem Muster ab, das Paolo Nestler für die Münchner U-Bahn entworfen hatte.
Album über Münchner U-Bahnhöfe
Der Stachus war einer der verkehrsreichsten Plätze Europas. Vor den Olympischen Sommerspielen 1972 entstand mit dem U- und S-Bahnhof Karlsplatz/Stachus sowie dem unterirdischen Einkaufszentrum das größte Untergrundbauwerk Europas.

Zwischen Stachus und Marienplatz wurde einige Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in München, am 30. Juni 1972, die erste Fußgängerzone in München eröffnet ‒ geplant und angelegt von den Architekten Bernhard Winkler und Siegfried Meschederu. Bis April 1968 war noch die Straßenbahn durch die Kaufingerstraße und Neuhauser Straße gefahren. Die Befürchtungen, der Stadtkern könne durch den Wegfall des Autoverkehrs absterben, weil sich die guten Geschäfte in der Fußgängerzone nicht mehr rentieren würden, bewahrheiteten sich nicht.
Als Austragungsort der Spiele wurde ein Areal im Norden der Stadt vorbereitet. Auf dem Oberwiesenfeld in Milbertshofen, wo sich von 1925 bis 1938 der erste bayrische Verkehrsflugplatz befunden hatte, arbeiteten nach der Grundsteinlegung am 14. Juli 1969 bis zu 8000 Menschen, um ein fast drei Quadratkilometer großes Sport- und Erholungsgelände zu gestalten. Der Generalentwurf für die Anlage stammte von einer Architektengruppe um Günter Behnisch, Fritz Auer, Carlo Weber, Erhard Tränkner und Winfried Büxel, die 1967 einen entsprechenden Wettbewerb gewonnen hatte.
Das »demokratische Grün« des Olympiaparks wurde von dem Landschaftsarchitekten Günther Grzimek gestaltet. Die zu einem 60 Meter hohen Schuttberg zusammengetragenen Trümmer aus dem Zweiten Weltkrieg verschwanden unter dem Rasen des »Olympiabergs«, und der Olympiasee entstand durch Aufstauung des Nymphenburg-Biedersteiner Kanals.
Günter Behnisch zog Frei Otto hinzu, dessen Deutscher Pavillon bei der Weltausstellung 1967 in Montreal das Vorbild für die an 58 Stahlmasten hängende Zeltdachkonstruktion war, mit deren Montage im Frühjahr 1971 begonnen wurde. Mit der Realisierung des Projekts, das bei der Auswahlentscheidung zunächst für undurchführbar gehalten worden war, festigte München sein Image als innovative Stadt. Umstritten war das Olympiadach auch wegen der hohen Kosten, aber Hans-Jochen Vogel argumentierte, eine Gesellschaft müsse die Kraft zu einer Investition in ein architektonisches Kunstwerk jenseits von Kosten-Nutzen-Kalkulationen haben.
Mit diesem antimonumentalen Bauwerk und der von Otl Aicher entwickelten visuellen Kommunikation in Regenbogenfarben rückten München und die Bundesrepublik Deutschland weit von den Gastgebern der Olympischen Spiele 1936 in Berlin ab. Bewusst vermieden die von Veranstalter alles Pompöse.
Der Fernsehturm stand zu Beginn der Bauarbeiten für die Sportstätten im Olympiapark bereits. Das Baureferat der Stadt München hatte ihn nach Plänen von Sebastian Rosenthal 1965 bis 1968 errichtet. Durch die Olympischen Spiele 1972 in München wurde der »Olympiaturm« zum Wahrzeichen des Olympiaparks.
Album über den Olympiapark
Bundespräsident Gustav Heinemann eröffnete am 26. August 1972 in Anwesenheit des Oberbürgermeisters Georg Kronawitter die XX. Olympischen Sommerspiele in München.
Weltoffene und »heitere Spiele« sollten es sein. Aber frühmorgens am 5. September 1972 überfielen acht Terroristen der palästinensischen Gruppe »Schwarzer September« das Quartier der israelischen Olympioniken im Olympischen Dorf in München in der Absicht, in israelischen Gefängnissen inhaftierte Palästinenser, aber auch die RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof freizupressen. Sie erschossen zwei israelische Sportler und nahmen neun weitere als Geiseln. Polizeikräfte riegelten das Gelände ab, während mit den Terroristen verhandelt wurde. Die Fernsehzuschauer konnten den ganzen Tag über das Geschehen am Bildschirm verfolgen.
Am Abend wurden die Geiseln und ihre Bewacher mit zwei Hubschraubern zum Militärflughafen in Fürstenfeldbruck gebracht. Als dort vier von fünf Scharfschützen um 22.38 Uhr das Feuer auf die acht Terroristen eröffneten, schossen diese mit Maschinenwaffen zurück. Um 0.05 berichtete Conrad Ahlers, der Sprecher der Bundesregierung, von einer geglückten »gut verlaufenen Aktion«. Aber zu diesem Zeitpunkt dauerte der Schusswechsel noch mehr als eine Stunde lang an. Aufgrund der Ausweglosigkeit schossen die Terroristen nun auch auf die Geiseln, und wer von ihnen nicht durch Schüsse umkam, starb bei Explosionen in bzw. unter den beiden Hubschraubern.
Alle neun Geiseln, ein Polizist und fünf Palästinenser starben. Obwohl 17 Menschen ums Leben gekommen waren, wurden die Wettkämpfe fortgesetzt. Die drei überlebenden, festgenommenen Terroristen wurden Ende Oktober 1972 durch die Entführung einer Lufthansa-Maschine freigepresst.
Eine Gedenktafel in der Connollystraße 31 und der 1995 im Olympiapark enthüllte zehn Meter breite Granitbalken des Bildhauers Fritz Koenig* erinnern an die elf getöteten Israelis und den ebenfalls umgekommenen Polizisten. In der Nähe des Klagebalkens befindet sich seit 2017 ein Pavillon als Ort es Gedenkens.
*) Mehr zu Fritz Koenig im Album über Kunst im öffentlichen Raum
Gedenktafel in der Connollystraße 31 / Fritz Koenig: Klagebalken im Olympiapark
Alben über den Olympiapark und das Olympiadorf
München Stadtgeschichte 1980
Oktoberfest-Attentat
Während des Oktoberfestes explodierte am 26. September 1980 am Haupteingang eine Bombe. Bei der Explosion starben 13 Menschen, 221 wurden verletzt. Der Attentäter Gundolf Köhler kam selbst um. Den offiziellen Ermittlungsergebnissen zufolge handelte das Mitglied rechtsradikaler Gruppierungen allein. Weil das umstritten blieb, ermittelte die Bundesanwaltschaft von 2014 bis 2020 noch einmal, konnte aber die These vom Einzeltäter nicht widerlegen.
Der Bildhauer Friedrich Koller gestaltete das im September 1981 enthüllte Denkmal für die zwölf Todesopfer des Attentats am Haupteingang der Wiesn: eine Bronze-Stele. Die Stahlwand dahinter wurde erst 2008 hinzugefügt. Auf der anderen Seite des Haupteingangs informiert seit 2020 eine Dokumentation über das Attentat.


Album über die Geschichte des Oktoberfests
München Stadtgeschichte nach 1972
Bussi-Bussi-Gesellschaft
Das Glockenbachviertel in der Isarvorstadt entwickelte sich ab den Sechzigerjahren zur angesagten Partymeile und Schwulenszene. (Heute würde man von einer LGBTIQ-Community reden.) 1974 bis 1978 war die »Deutsche Eiche« Rainer Werner Fassbinders Stammlokal, und als Freddie Mercury von 1979 bis 1985 in München lebte, logierte er in der »Deutschen Eiche«.
Franco Notonica schuf 2024 an der Fassade der »Deutschen Eiche« ein Glasmosaik mit einem Porträt des Musikers und im Jahr darauf ein weiteres mit dem Konterfei des Filmemachers. Porträts von Freddie Mercury und Rainer Werner Fassbinder sind auch am mehr als hundert Jahre alten Pissoir am Holzplatz zu sehen ‒ neben Albert Einstein, der ebenfalls vorübergehend im Glockenbachviertel gewohnt hatte.
Porträts an der »Deutschen Eiche« und am Pissoir auf dem Holzplatz
Die neue Freiheit zeigte sich auch im Englischen Garten: In den Siebziger- und Achtzigerjahren tummelten sich zum Beispiel auf der Schönfeldwiese und der Großen Carl-Theodor-Wiese am Schwabinger Bach Tausende von Nackten in der Sonne, und das empfanden nur wenige als anstößig. Inzwischen sind im Englischen Garten und an der Isar offizielle Nacktbade-Bereiche ausgewiesen – aber außer ein paar Altachtundsechzigern zeigt sich dort kaum noch jemand ohne Badehose. Sogar »oben ohne« ist verpönt – obwohl mehrere Gerichte urteilten, dass Frauen aus Gründen der Gleichberechtigung grundsätzlich mit nacktem Oberkörper (sonnen-)baden dürfen.
Schwabing knüpfte ab den Siebzigerjahren an die Bohème-Szene der Prinzregenten-Zeit an, nun als Bussi-Bussi-Gesellschaft, die den beidseitig angedeuteten Wangenkuss »erfand«. Treffsicher vorgeführt wurde diese exaltierte Münchner Schickeria von Helmut Dietl in seiner 1986 ausgestrahlten Fernsehserie »Kir Royal«. Die von Franz Xaver Kroetz bzw. Ruth Maria Kubitschek gespielten Figuren Jakob (»Baby«) Schimmerlos und Friederike von Unruh sind Persiflagen auf den Klatschreporter Michael Graeter der »Abendzeitung« und die Herausgeberin der Zeitung, Anneliese Friedmann. Helmut Dietl spiegelte die Münchner Gesellschaft nicht nur in »Kir Royal«, sondern auch in »Münchner Geschichten« (1974/75), »Monaco Franze – Der ewige Stenz« (1983) und »Rossini oder Die mörderische Frage, wer mit wem schlief« (1997).
Als 1997 bzw. 2022 vom Bildhauer Nikolai Tregor gestaltete Bronzefiguren sitzen Helmut Dietl und Helmut Fischer – der Schauspieler, der den »Monaco Franze« verkörpert hatte – vor dem Café »Münchner Freiheit«.
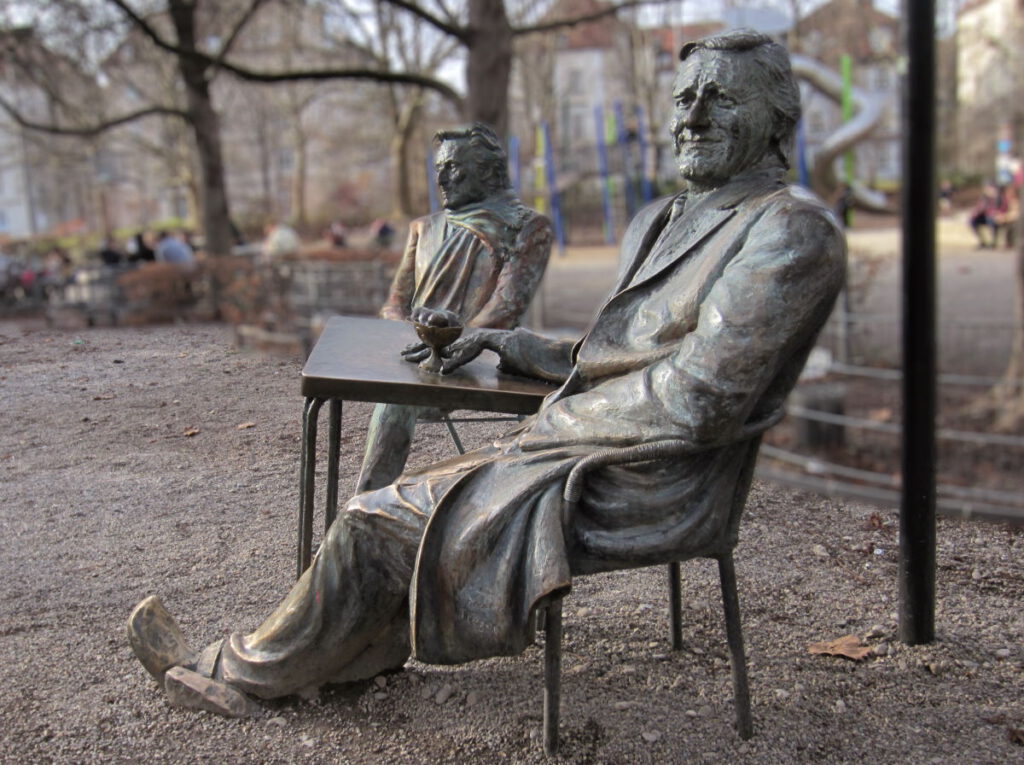
Münchner Freiheit: Helmut Dietl und Helmut Fischer
München Stadtgeschichte nach 1972
Neubauten in München
Am 1. Oktober 1949 hatte das → Deutsche Patentamt in München seine Pforten geöffnet. Wer sich jedoch eine Erfindung nicht nur in Deutschland, sondern in mehreren europäischen Staaten patentieren lassen wollte, musste bei den nationalen Patentämtern durch einen dort zugelassenen Vertreter eine Patentschrift in der jeweiliger Amtssprache einreichen – bis 1978 das → Europäische Patentamt in München eingerichtet wurde. Seither kann jede natürliche oder juristische Person, unabhängig von der Staatsangehörigkeit und vom Sitz, mit einer einzigen Patentanmeldung in deutscher, englischer oder französischer Sprache für alle beteiligten Staaten zugleich ein Patent erhalten. Der Gebäudekomplex am Bob-van-Benthem-Platz gegenüber dem Deutschen Museum war 1975 bis 1979 nach Entwürfen der Architekten Volkwin Marg und Andreas Sack vom Büro Gerkan, Marg und Partner (GMP) errichtet worden. Auf dem Gelände sind übrigens eine Reihe von Kunstwerken im öffentlichen Raum zu sehen.


Mit dem Konzept eines sowohl in seinem Inneren als auch von innen nach außen und in umgekehrter Richtung »offenen Hauses« hatte die Architektengemeinschaft Raue-Rollenhagen-Lindemann-Grossmann den 1972 ausgeschriebenen Ideenwettbewerb für die Gestaltung eines Münchner Kulturzentrums gewonnen. Nach der Grundsteinlegung am 28. April 1978 in Haidhausen begannen die Bauarbeiten. Im Mai 1984 konnte die Münchner Stadtbibliothek ihre neuen Räume beziehen, und im November 1985 folgten die Münchner Philharmoniker. Aus grauem Sichtbeton, rotbraunen Ziegeln und spiegelnden Glasflächen bestehen die Außenwände der verschachtelten Baukörper, aus denen sich der riesige Gebäudekomplex zusammensetzt. Wuchtig und burgartig wirkt das Kulturzentrum (»Kulturbunker«, »Kulturvollzugsanstalt«) nicht zuletzt auch deshalb, weil es am Gasteig – einer Anhöhe am rechten Isarufer – aufragt.

Vom 1900 bis 1905 im Osten des → Hofgartens nach Plänen von Ludwig Mellinger für das → Bayerische Armeemuseum errichtete Bauwerk im Stil monumentaler Neurenaissance existierte nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch der zentrale Kuppelbau. (1969 wurde das Bayerische Armeemuseum in das Neue Schloss in Ingolstadt verlegt.) Um die Ruine herum wollte Ministerpräsident Franz Josef Strauß einen Neubau der → Bayerischen Staatskanzlei errichten. Einen dafür ausgeschriebenen Wettbewerb gewann 1982 das Architektenteam Diethard J. Siegert und Reto Gansser. Eine Protestwelle gegen die Pläne verzögerte die Ausführung. Reto Gansser zog sich aus dem umstrittenen Projekt zurück, und Diethard Siegert modifizierte die Pläne, verzichtete auf die Seitenflügel und ersetzte die Mauern auf der Hofgartenseite durch Glas. Im Mai 1993 zog Ministerpräsident Edmund Stoiber dort ein.


Die Alte Pinakothek war zwar im Krieg stark beschädigt worden, aber die Bestände hatte man rechtzeitig ausgelagert, und Hans Döllgast leitete 1946 bis 1957 die Restaurierung.
Die Eröffnung des Neubaus der im Zweiten Weltkrieg zerstörten und 1949 abgerissenen Neuen Pinakothek nördlich der → Alten Pinakothek bildete im März 1981 den Auftakt für die Entstehung des »Kunstareals« in der Maxvorstadt. Der Grundstein für das von Alexander Freiherr von Branca 1967 entworfene Bauwerk war 1975 gelegt worden.
Das vom Architekten Stephan Braunfels 1992 entworfene Gebäude der Pinakothek der Moderne folgte 2002. Es war der größte im 20. Jahrhundert in Deutschland ausgeführte Museumsbau. Daneben, ebenfalls auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne, baute man bis 2009 das → Museum Brandhorst für die Kunstsammlung der Udo und Anette Brandhorst Stiftung. In einem weiteren Neubau im Kunstareal richtete sich 2013 neben der »Hochschule für Fernsehen und Film München« das »Staatliche Museum Ägyptischer Kunst« ein.


Alben über die Pinakotheken und das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst
Alben über die Pinakothek der Moderne und das Museum Brandhorst (beide privat)
In einem vom ehemaligen Münchner Oberbürgermeister Georg Kronawitter nach seiner Amtszeit initiierten Bürgerentscheid votierte 2004 eine knappe Mehrheit bei einer Wahlbeteiligung von nur 21,9 Prozent gegen neue Gebäude in München, die höher als die Türme der Frauenkirche sein würden. Allerdings standen zu diesem Zeitpunkt bereits einige »Wolkenkratzer«: → BMW-Vierzylinder in Milbertshofen (1972, 101 m), → HVB-Tower in Bogenhausen (1981, 114 m), Hochhaus »Uptown« in Moosach (2004, 146 m), → Highlight Towers in Schwabing-Nord (2004, 126 bzw. 113 m). Das Hochhaus des Süddeutschen Verlags in Zamdorf wurde dann 2006 bis 2008 nur 103 statt 145 Meter hoch gebaut. Inzwischen ist das Thema erneut aktuell, denn die Büschl-Unternehmensgruppe möchte im geplanten Quartier an der Paketposthalle in Neuhausen zwei 155 Meter hohe Türme bauen ‒ und der Münchner Stadtrat hat im November 2025 mit großer Mehrheit zugestimmt.





Am 9. November 2003 – auf den Tag genau 65 Jahre nach der Zerstörung der Münchner Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße (→ Mahnmal) – wurde der Grundstein für den Neubau am Sankt-Jakobs-Platz im Angerviertel gelegt. Ein für den Festakt geplanter Sprengstoffanschlag konnte verhindert werden. 2006 fand die Einweihung der neuen, von dem Saarbrückener Architektenbüro Wandel, Hoefer und Lorch gestalteten Synagoge Ohel Jakob (Zelt Jakobs) statt. Der massive Unterbau und der leichte Aufsatz stehen für Stabilität und Fragilität, Tempel und Zelt. Verkleidet ist das kubische Gebäude mit Travertin-Platten von der Schwäbischen Alb. Übrigens betritt man die Synagoge nicht durch das sechs Meter hohe Hauptportal. Der Zugang erfolgt stattdessen über einen 32 Meter langen Tunnel – einen »Gang der Erinnerung« – vom Jüdischen Gemeindezentrum aus.


München Stadtgeschichte ab 1957
Millionendorf München
Am 15. Dezember 1957 überschritt die Einwohnerzahl Münchens die Millionengrenze. Und der Zuzug hält weiter an. Inzwischen wohnen mehr als eineinhalb Millionen Menschen in der bayrischen Landeshauptstadt, und mit 4.844 Einwohnern pro Quadratkilometer ist München die am dichtesten bevölkerte Gemeinde Deutschlands.
Der Journalist Werner Friedmann (1909 – 1969) prägte das Oxymoron »Millionendorf« Ende November 1957 in der Süddeutschen Zeitung, und er kritisierte damit, dass die Infrastruktur der Stadt München nicht mit dem Wachstum Schritt hielt. Der Begriff verbreitete sich – und wechselte dabei von einer negativen zu einer positiven Konnotation. Wer heute »Millionendorf« sagt, meint damit die besondere Verknüpfung von Urbanität und Natürlichkeit.
Tatsächlich sind heute noch ursprüngliche Dorfkerne eingemeindeter Kommunen erkennbar, beispielsweise in Perlach und Großhadern, Forstenried, Solln, Untersendling, Allach, Aubing und Johanneskirchen. In Ramersdorf dagegen blieb vom alten Dorfkern um die Kirche und den Alten Wirt lediglich eine Insel zwischen stark befahrenen Straßen übrig.
Ehemalige »Glasscherbenviertel« wie Haidhausen, Untergiesing, Obergiesing, das Glockenbachviertel in der Isarvorstadt und die Schwanthalerhöhe wurden gentrifiziert.
Berlin war von 1945 bis 1989 nur per Flugzeug oder durch Korridore in der sowjetisch besetzten Zone bzw. DDR erreichbar. Bis das Parlament, der Bundespräsident und die Bundesregierung von Bonn nach Berlin ziehen konnten (Beschluss: 1991, Durchführung: 1999 ‒ 2001), galt München als »Deutschlands heimliche Hauptstadt« (»Der Spiegel« 23. September 1964).
Nach dem Zweiten Weltkrieg zog Siemens von Berlin nach München, und Obersendling wurde »Siemensland«. Nach Plänen des Architekten Emil Freymuth entstand Anfang der Fünfzigerjahre die Siemens-Wohnsiedlung in Obersendling. Markant sind zwei wegen ihrer Grundrisse als »Sternhäuser« bezeichnete Hochhäuser. (Das »Sternhaus III« in der Leo-Graetz-Straße kam erst 2006/07 dazu.) Aber nach der Jahrtausendwende gab Siemens den Standort auf und verkaufte die Liegenschaften, 2009 auch den im Jahr zuvor sanierten Wohnungsbestand in Obersendling.
Seit Siemens nach München gezogen ist, hat sich die Stadt unter dem Motto »Tradition und Moderne« (»Lederhose und Laptop«) zum Magneten für Forschung, Wissenschaft und Hightech entwickelt.
Sowohl die → Ludwig-Maximilians-Universität als auch die → Technische Universität München ‒ beide mit jeweils mehr als 50.000 Studierenden ‒ gelten als Elite-Hochschulen. Die TUM betrieb 1957 bis 2000 den Forschungsreaktor Garching und arbeitet seit 2004 mit dessen Nachfolger, der nach dem deutschen Kernphysiker Heinz Maier-Leibnitz benannten Forschungs-Neutronenquelle, ebenfalls in Garching.
Aus dem 1974 in Betrieb genommenen Klinikum Großhadern ging 1994 der Campus Großhadern/Martinsried der LMU hervor, der mit den benachbarten Max-Planck-Instituten für Biochemie und biologische Intelligenz sowie dem Helmholtz Zentrum München zusammen Spitzenforschung in Medizin und Naturwissenschaften betreibt. Die Generalverwaltung der 1948 als Nachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründeten Max-Planck-Gesellschaft befindet sich in München (Hofgartenstraße 8).

Vor dem Eingang in der Hofgartenstraße 8 steht eine mehr als sechs Meter hohe Granitskulptur
des Künstlers Fernando de la Jara mit dem Titel »Minerva« aus dem Jahr 1999.
Die Negativform zur Göttin symbolisiert die materielle Welt, im Gegensatz zu Welt der Ideen und Gedanken.
Dazu kommt die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung. Und bei der 1759 gegründeten Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München handelt es sich sowohl um die größte als auch eine der ältesten auf Landesebene organisierten Wissenschaftsakademien in Deutschland. Zu ihr gehören das Leibniz-Rechenzentrum, das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation und die Kommission für bayerische Landesgeschichte sowie das Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung in Garching.
Laut einer Studie der EU-Kommission aus dem Jahr 2014 gilt München als führender IT-Standort in Europa (»Isar Valley«). Im Global Tech Ecosystem Index 2025 schaffte es München auf Platz 17 und war damit als einzige deutsche und eine von vier europäischen Städten unter den Top 20 der weltweit führenden Technologiezentren. IT-Giganten wie IBM, Microsoft, Amazon, Apple und Google unterhalten inzwischen Niederlassungen in München.
Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in München Wohnungsnot, aber der Wohnungsbau konnte auch nicht mit dem anhaltenden Zuzug Schritt halten, und weil davon auch Studierende betroffen waren, initiierten Ende der Fünfzigerjahre Rektoren und Professoren der Hochschulen mit dem Geschäftsführer des Studentenwerks München den Bau einer Studentenstadt nach dem Vorbild der Cité Internationale Universitaire de Paris, und 1959 wurde der Verein Studentenstadt München e. V. gegründet. Der Freistaat Bayern stellte für das Vorhaben ein Areal in Freimann am Rand des Englischen Gartens zur Verfügung, und Ernst Maria Lang (Architekturgemeinschaft Lang und Pogadl) gewann 1960 einen entsprechenden Architekturwettbewerb. 1961 begannen die Bauarbeiten. Bis 1968 entstand die kleinteilig bebaute »Altstadt«, und 1971 bis 1977 folgten die Hochhäuser der »Neustadt«. So entstand die größte Studentensiedlung Deutschlands, die 1972 um die Bungalows im Olympiadorf ergänzt wurde.
Studentenstadt / Olympiadorf
Aufgrund des Bevölkerungswachstums der Stadt München wurde Anfang der Sechzigerjahre der Bau der Trabantenstadt Neuperlach projektiert. Der Architekt Egon Hartmann leitete die Planung. Gebaut wurde von 1967 bis 1991. Es war das bis dahin größte westdeutsche Siedlungsprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg. Bemerkenswert ist die Schaffung autofreier Bereiche. Heute wohnen 55.000 Menschen in Neuperlach.
Urban Art von Peeta am Karl-Marx-Ring in Neuperlach: Illusion einer Dreidimensionalität
Zur Konzeption der Trabantenstadt Neuperlach gehörte die Realisierung eines bereits nach dem Ersten Weltkrieg angedachten Projekts: ein Park im Osten von München. Der Landschaftsarchitekt Ludwig Roemer entwarf dazu 1965 auf Feld- und Ackerflächen eine Landschaft mit See, Wiesen und Baumgruppen. Die Hügel wurden mit dem Schutt aufgeschüttet, der beim Bau von Neuperlach und der U-Bahn anfiel. Der Gartenarchitekt Josef Wurzer gestaltete den buchtenreichen Ostparksee, der aus Grundwasserbrunnen gespeist wird. Als der erste Bauabschnitt 1975 der Öffentlichkeit übergeben wurde, beschloss der Münchner Stadtrat den Weiterbau, der dann 1979 bis 1982 erfolgte.
Münchner Ostpark
Album über den Ostpark
Parallel zum Ostpark legte der Garten- und Landschaftsarchitekt Gottfried Hansjakob 1977 den → Neuen Südfriedhof in Perlach an. Das mehr als 35 Hektar große Gelände ‒ ebenfalls mit einem künstlichen See ‒ wirkt noch immer wie ein Park.

München bewarb sich im Mai 1977 für die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 1983 – und erhielt im Juli den Zuschlag. Bereits im Jahr zuvor hatte die bayrische Landeshauptstadt einen Architektenwettbewerb für die Anlage eines weiteren Parks – des Westparks – auf einem fast unbebauten Brachland im (1992 aufgelösten) Waldfriedhofviertel ausgeschrieben. Der Entwurf des Münchner Landschaftsarchitekten Peter Kluska überzeugte die Jury Anfang 1977. So entstand von 1978 bis 1983 der zweieinhalb Kilometer lange, 69 Hektar große Westpark mit künstlichen Hügeln und zwei Seen. Dabei pflanzte man nicht nur 100.000 Sträucher, sondern auch mehr als 6000 zwanzig bis vierzig Jahre alte Bäume an.
Album über den Westpark
Im Mai 1992 wurde der Flughafen München-Riem durch den neuen Flughafen »Franz Josef Strauß« im Erdinger Moos ersetzt. Auf einem Teil des aufgegebenen Flughafengeländes entstanden ab 1994 zunächst die »Messestadt« und dann auch der → Riemer Park für die Bundesgartenschau 2005. Bei der → Messestadt Riem handelt es sich um eine weitgehend autofreie Wohnsiedlung für 16.000 Menschen. 1998 zog die Messe München in die ab 1994 gebauten Ausstellungshallen in Riem. (1964 bis 1998 hatte die Münchner Messe- und Ausstellungsgesellschaft die 1907/08 am → Bavariapark auf der Theresienhöhe nach Entwürfen von Wilhelm Bertsch gebauten drei Messehallen genutzt.)


Die Isar fließt auf einer Länge von 13,7 Kilometern durch München (»Isar-Metropole«). Von Februar 2000 bis Juni 2011 wurde der Wildfluss zwischen der → Großhesseloher Brücke und der → Corneliusbrücke auf einer Länge von acht Kilometern renaturiert und in der Breite verdoppelt. Der »IsarPlan« diente nicht nur – wie der in den Fünfzigerjahren angelegte Sylvensteinsee bei Lengries – dem Hochwasserschutz. Auen und Kiesbänke bilden seither ein Freizeit- bzw. Naherholungsgebiet, das auf beiden Ufern mit Spazier-, Wander- und Fahrradwegen sehr gut erschlossen ist.
Album über die Isar
Obwohl es heißt, München sei in Deutschland die Stadt mit dem höchsten Anteil an versiegelter Fläche (47%), sind hier überall Parks und Grünanlagen zu finden.
Alben über Grünanlagen und Spazierwege im Grünen
München ist unerschöpflich. Das gilt für kulturelle Veranstaltungen, Bildungseinrichtungen, Theater und Museen, Ausstellungen, historische Bauwerke und andere Sehenswürdigkeiten, Kunst am Bau und im öffentlichen Raum, Streetart, Denkmäler und Brunnen, Parks und Grünanlagen. Entsprechend groß ist auch die Palette möglicher Aktivitäten ‒ vom Spaziergang bis zum Konzertbesuch.
Die Attraktivität und Lebensqualität der als »Isar-Metropole«, »Millionendorf« und »Weltstadt mit Herz« bezeichneten Stadt München hat ihren Preis: Nirgendwo in Deutschland ist Wohnen so teuer wie in München.
München Stadtgeschichte 2016
Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum
Am 22. Juli 2016, dem fünften Jahrestag der Anschläge des norwegischen Rechtsextremisten Anders Behring Breivik in Oslo und auf der Insel Utøya, schoss der in München geborene 18-jährige Deutsch-Iraner David Sonboly mit einer Pistole im Schnellrestaurant gegenüber dem → Olympia-Einkaufszentrum mindestens 18-mal auf eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern. Fünf Menschen starben, und ein Kind wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter lief dann ins Freie und schoss auf Passanten, bevor er die Hanauer Straße überquerte und das Einkaufszentrum betrat. Als die Polizei eintraf, befand sich David Sonboly auf dem obersten Deck des OEZ-Parkhauses. Er entkam und versteckte sich eineinhalb Stunden lang, bis er von einer Streife gestellt wurde und sich daraufhin mit einem Kopfschuss tötete. Allerdings herrschte noch stundenlang Alarm – denn die Polizei befürchtete, dass noch Komplizen des Täters unterwegs waren. Zahlreiche Notrufe, Hinweise auf angeblich Bewaffnete und andere Meldungen vor allem in den Social Media sorgten für eine verwirrende Informationsflut. Sogar Landesgrenzen wurden gesichert, und ein SEK aus Österreich kam der Polizei in München mit fünf Hubschraubern zu Hilfe. Insgesamt waren 2300 Einsatzkräfte aktiv.
Sieben der neun Todesopfer waren Muslime. Mindestens 36 Menschen wurden verletzt.
Am ersten Jahrestag des Attentats wurde bei dem Schnellrestaurant an der Hanauer Straße gegenüber dem Olympia-Einkaufszentrum ein von der Münchner Künstlerin Elke Härtel (*1978) gestaltetes Mahnmal enthüllt: »Für Euch«. Ein großer, schräg aufragender Ring aus Edelstahl mit den Namen und Porträts der Todesopfer umschließt einen Ginkgobaum. Die Inschrift ließ auf einen unpolitischen Amoklauf schließen. Davon gingen die Ermittler zunächst aus. Aber im Lauf der Zeit änderte sich die Einschätzung, und inzwischen wird ein rassistischer und rechtsextremer Anschlag angenommen. 2020 änderte man deshalb die Inschrift des Mahnmals. Sie lautet nun: »In Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats vom 22. 7. 2016«.

München Stadtgeschichte 2016 ‒ 2035
Zweite Stammstrecke
Das von der DB Regio betriebene S-Bahn-Netz reicht weit ins Münchner Umland. Engpass ist die im Rahmen des MVV von allen Linien befahrene Stammstrecke zwischen → Ostbahnhof und Pasing.
Nach jahrzehntelanger Diskussion über eine zweite Stammstrecke der S-Bahn einigten sich Bund, Land, Stadt und Bahn 2016 auf den Bau einer weiteren, elf Kilometer langen Verbindung zwischen Laim und → Leuchtenbergring, sieben Kilometer davon in einem neuen Tunnel. 2017 erfolgte auf dem Marienhof der Spatenstich zum Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke. Die zunächst für 2028 geplante Fertigstellung hat sich inzwischen auf 2035 verschoben, und die Kostenschätzung von 3,8 auf 7 Milliarden Euro verdoppelt. Einer der Bahnhöfe wird 41 Meter unter dem Marienhof gebaut.


Im Oktober 2021 begann die Bahn, das Relais-Stellwerk am Ostbahnhof aus dem Jahr 1971 durch ein elektronisches zu ersetzen. 400 Kilometer Kabel wurden verlegt. Mit zwei Jahren Verspätung gegenüber der ursprünglichen Planung konnte die neue, 195 Millionen Euro teure Anlage im Juni 2025 in Betrieb genommen werden. Personal ist dort nicht vorgesehen. Zwei von zwölf Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale an der → Donnersbergerbrücke schalten über das Stellwerk am Ostbahnhof 150 Signale und 60 Weichen der Münchner S-Bahn. Ein Teil des Gebäudes an der Friedenstraße 23 steht noch leer. Dort soll das Stellwerk für die zweite Stammstrecke entstehen.

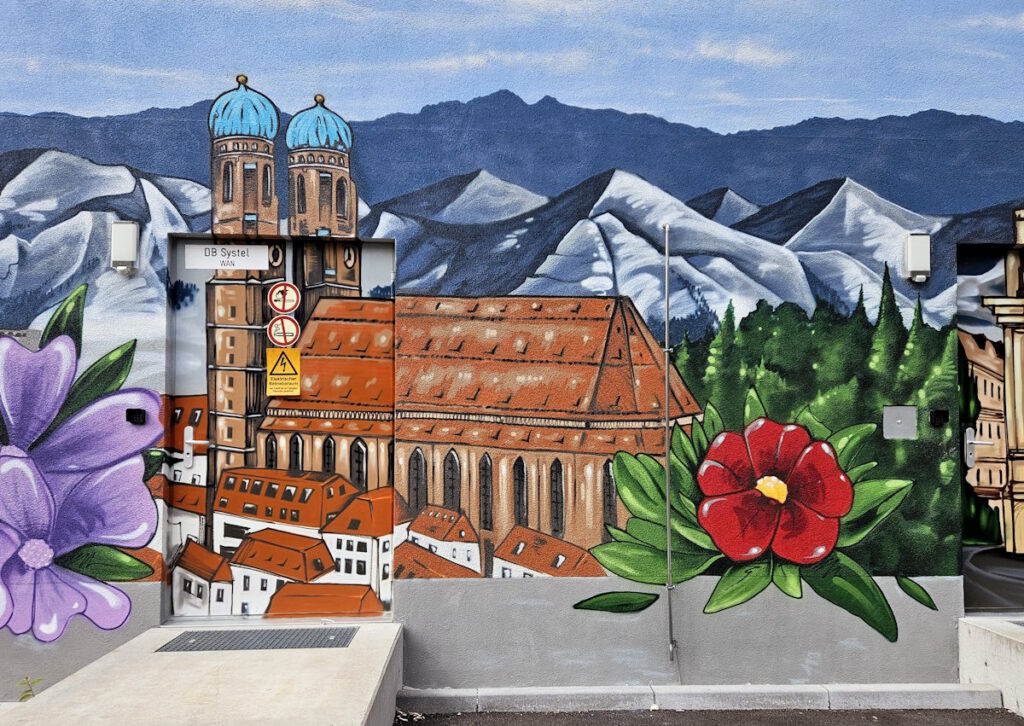
Literatur:
. Lothar Altmann: Streifzüge durch Münchens Kunstgeschichte. Von der Romanik bis zur Gegenwart (Regensburg 2008)
. Richard Bauer: Geschichte Münchens. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (München 2003/2008)
. Richard Bauer, Eva Graf: Stadtvergleich. Münchner Ansichten (München 1985)
. Corinna Erhard: München in 50 Antworten (München 2011)
. Corinna Erhard: München in 50 weiteren Antworten (München 2023)
. Fritz Fenzl: Münchner Stadtgeschichten. Von den Ursprüngen bis heute (München 1994/2008)
. Peter Claus Hartmann: Münchens Weg in die Gegenwart. Von Heinrich dem Löwen zur Weltstadt (Regensburg 2008)
. Reinhard Heydenreuter: Kleine Münchner Stadtgeschichte (Regensburg 2007/20122)
. Norbert Huse: Kleine Kunstgeschichte Münchens. München 1990/20094)
. Anna Kurzhals: »Millionendorf« und »Weltstadt mit Herz«. Selbstdarstellung der Stadt München 1945 ‒ 1978 (München 2018)
. Zara S. Pfeiffer: Die Geschichte der Frauenbewegung in München (ThemenGeschichtsPfad, München 20143)
. Christine Rädlinger: Geschichte der Münchner Brücken. Brücken bauen von der Stadtgründung bis heute (München 2008)
. Georg Reichlmayr: Geschichte der Stadt München von den Anfängen bis heute (München 2020)
. Michael Schattenhofer: Beiträge zur Geschichte der Stadt München (München 1984)
. Michael Schattenhofer: Wirtschaftsgeschichte Münchens. Von den Anfängen bis zur Gegenwart (München 2011)
. Erwin Schleich: Die zweite Zerstörung Münchens (Stuttgart 1978/812)
. Duncan J. D. Smith: Nur in München (Wien 2009)
. Otto Zierer, Anton Kammerl: München. Eine Stadt und ihre Geschichten aus 850 Jahren (München 2007)
Externe Links:
Bei einigen Beiträgen finden Sie passende externe Links.
Hier sind noch ein paar Websites, die ganz München betreffen:
. München Wiki
. Stadtgeschichte München
. Das offizielle Stadtportal
. Offizielle Tourismus-Website der Stadt München