München: Parks und Grünanlagen
Obwohl es heißt, München sei in Deutschland die Stadt mit dem höchsten Anteil an versiegelter Fläche (47%), treffen Sie hier überall auf Parks und Grünanlagen.
Schon Friedrich Ludwig von Sckell (1750 – 1823) verstand das Naturerlebnis als eine Kraft, die dem Menschen psychisch und physisch gut tut. Ab 1789 war er maßgeblich an der Anlage des Englischen Gartens in München und der Umgestaltung des Schlossparks Nymphenburg beteiligt. Dabei orientierte er sich nicht an geometrisch geformten Barockgärten, sondern an der Natur und gilt als Begründer der klassischen Phase des englischen Landschaftsgartens in Deutschland.
Der Englische Garten ist weltbekannt, aber der acht Kilometer lange Park ist nicht nur mit dem → Dichtergarten und → Hofgarten, sondern auch mit den Isar– und Maximiliansanlagen verbunden. Über die ganze Stadt verteilt gibt es grüne Oasen, weit mehr als hier vorgestellt werden können. Im Sommer 2025 entstand im Stadtrat die »Vision 3-30-300«: In München sieht jede Bewohnerin und jeder Bewohner beim Blick aus dem Fenster drei Bäume; 30 Prozent des Straßenraums befinden sich im Schatten von Bäumen und niemand muss weiter als 300 Meter zur nächsten Grünfläche gehen.
Dieses Album zeigt einige der zahlreichen Parks und Grünanlagen in München. Ein eigenes Album ist Gewässern gewidmet ‒ die fast immer von Grünflächen umgeben sind: Bäche, Seen und Weiher. Und Spazierwege im Grünen finden Sie in einem weiteren Album.
Altstadt
Münchner Stadtbezirk 1: Altstadt-Lehel
Promenadeplatz
Wo sich heute der Promenadeplatz befindet, hatten bis 1778 die Salzstadel der Stadt gestanden. Nach deren Abriss wurde das Areal im Zentrum des Kreuzviertels einige Zeit als Paradeplatz genutzt und 1804 zu einer Grünanlage umgestaltet. Zwischen den Bäumen stehen Denkmäler für Orlando di Lasso, Kurfürst Maximilian II. Emanuel, Christoph Willibald von Gluck, Lorenz von Westenrieder und Maximilian Graf von Montgelas.

Maximiliansplatz
Auf dem 1801 bis 1804 durch Auffüllung des Stadtgrabens entstandenen Maximiliansplatz fanden ab 1819 Dulten und Pferdemärkte statt. Der heutige Name tauchte 1808 auf. Damit ist Maximilian I. Joseph gemeint, der 1806 durch ein Bündnis mit Napoleon zum ersten bayrischen König avancierte. 1805 bis 1810 planten Friedrich Ludwig von Sckell und Karl von Fischer für ihn die → Maxvorstadt als erste planmäßige Stadterweiterung Münchens, und der Maximiliansplatz war als Übergangszone von der Altstadt in die Maxvorstadt konzipiert. 1864 wurde der Hofgärtner Carl von Effner (1831 – 1884) beauftragt, die »Münchner Sahara« als Park neu zu gestalten, aber das Vorhaben konnte erst 1875/76 verwirklicht werden. Heute handelt es sich um eine der Grünanlagen mitten in der Stadt.

Hofgarten
Als Herzog Wilhelm IV. von Bayern die Residenz der Wittelsbacher vom → Alten Hof in die Neuveste verlegte, ließ er ab 1526 anstelle eines wohl schon Anfang des 15. Jahrhunderts existierenden »Baumgartens auf dem Bach« nördlich der Residenz einen Park im Stil der italienischen Renaissance anlegen, den Kurfürst Maximilian I. 1613 bis 1617 zum heutigen Hofgarten erweiterte und Kurfürst Karl Theodor um 1780 zumindest teilweise für die Bevölkerung öffnete. Bei der Neuanlage des im Zweiten Weltkrieg verwüsteten Hofgartens wählte der Gartenarchitekt Kurt Hentzen (1906 – 1960) eine Kombination aus Renaissance- und Landschaftsgarten nach historischen Vorbildern.


Mehr zum Hofgarten im Album übers Graggenauer Viertel der Altstadt
Dichtergarten
Auf den nicht mehr militärisch benötigten Wallanlagen einer Bastion aus dem Dreißigjährigen Krieg legten die Theatiner ab 1664 einen Nutzgarten an. Im Zuge der Säkularisation ersteigerte Abbé Pierre de Salabert, der Erzieher der Prinzen Carl August und Maximilian Joseph, 1802 das Areal und ließ 1804 bis 1806 nach Plänen des Architekten Karl von Fischer ein Palais bauen (das heutige → Prinz-Carl-Palais). Nach Salaberts Tod 1806 oder 1807 erreichte der königliche Gartenarchitekt Ludwig von Sckell, dass König Maximilian I. Joseph das Areal erwarb. Damit wollte er eine Verbindung zwischen dem Hofgarten und dem Englischen Garten herstellen, aber das Grundstück – inzwischen wegen der vorübergehenden Nutzung durch den bayrischen Finanzminister als Finanzgarten bezeichnet ‒ blieb bis 1969 für die Öffentlichkeit unzugänglich. Seit der Einrichtung einer → Heinrich-Heine-Gedenkstätte (1962) und der Aufstellung eines Denkmals für Fjodor Iwanowitsch Tjuttschew (2003) spricht man vom Dichtergarten. (Mehr dazu im Album über Denkmäler.)

Lehel
Münchner Stadtbezirk 1: Altstadt-Lehel
Isarpromenade
Von der → Widenmayerstraße wurde nur die westliche Seite bebaut; an der Isar entlang verläuft eine Promenade ‒ und am anderen Ufer ist ein Abschnitt der Maximiliansanlagen zu sehen.



Ludwigsvorstadt
Münchner Stadtbezirk 2: Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
Nußbaumpark
Der Nußbaumpark westlich des → Sendlinger Tors wurde ab 1872 nach alten Plänen von Friedrich Ludwig von Sckell (1750 – 1823) angelegt, möglicherweise unter Leitung des Gartenarchitekten Max Kolb (1829 – 1915).

Isarvorstadt
Münchner Stadtbezirk 2: Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
Alter Südfriedhof
Herzog Albrecht V. ließ 1563 vor den Toren der Stadt einen Pestfriedhof anlegen. Von 1788 bis 1868 war der Alte Südfriedhof die einzige Begräbnisstätte Münchens. Der aus Mannheim stammende Münchner Wein- und Pferdehändler Johann Balthasar Michel, der am 13. August 1818 im Alter von 63 Jahren starb, wurde als erster Protestant auf dem Alten Südfriedhof bestattet. Unter den 18.000 Gräbern sind auch die berühmter Persönlichkeiten wie Gärtner, Klenze, Kaulbach und Schwanthaler zu finden. 1898 beschloss der Magistrat einen Zeitplan für die Auflassung des Alten Südfriedhofs, und seit dem 1. Januar 1944 hat es dort keine Beerdigungen mehr gegeben. 1954/55 wurde der Friedhof nach Plänen von Hans Döllgast umgestaltet, und heute dient die denkmalgeschützte Anlage als Park.


Westermühlbach
Der mehr als einen Kilometer lange Westermühlbach zweigt vom Großen Stadtbach ab und plätschert in einem schmalen Grünstreifen nach Norden, bis er unter dem Haus Pestalozzistraße 35 verschwindet. Am Westermühlbach entlang verläuft der nach Alexander Miklósy, dem »Bürgermeister der Isarvorstadt«, benannte Weg. (Mehr dazu im Album über die Isarvorstadt.)



Gärtnerplatz
Der Gärtnerplatz in der Isarvorstadt wurde um 1860 von dem Gartenkünstler Max Kolb (1829 – 1915) zu Ehren des Architekten Friedrich von Gärtner (1791 – 1847) angelegt, der neben Leo von Klenze (1784 – 1864) als bedeutendster Architekt des 19. Jahrhunderts in Bayern gilt. Das heutige Aussehen erhielt der Gärtnerplatz 2006.


Maxvorstadt
Münchner Stadtbezirk 3: Maxvorstadt
Alter Botanischer Garten
Der Landschaftsarchitekt Friedrich Ludwig von Sckell gestaltete 1804 bis 1812 die Anlage, die seit der Verlegung des Botanischen Gartens nach Nymphenburg (1914) Alter Botanischer Garten heißt.

Pflaum Park
Die Ende des 19. Jahrhunderts errichteten, inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Backstein-Gebäude der ehemaligen Garnisonsverwaltung in der Lazarettstraße werden vom Pflaum Verlag genutzt.


Maßmannpark
Bereits als Berliner Gymnasiast engagierte sich Hans Ferdinand Maßmann (1797 – 1874) in der Bewegung des »Turnvaters« Friedrich Ludwig Jahn (1778 – 1852). 1826 rief ihn König Ludwig I. als Turnlehrer des bayrischen Kadettenkorps nach München, und zwei Jahre später errichtete Hans Ferdinand Maßmann eine öffentliche Turnanstalt in der Maxvorstadt. Nachdem er sich parallel dazu habilitiert hatte und außerordentlicher Professor der → Ludwig-Maximilians-Universität geworden war, erhielt er 1835 einen der ersten Lehrstühle für Germanistik.
Nach dem Zweiten Weltkrieg legte die Stadt München statt der zerstörten Turnanstalt den Maßmann-Park an. Der wurde 2009 restauriert und mit neuen Sportgeräten bzw. -anlagen ausgestattet.

Alter Nördlicher Friedhof
Kurfürst Karl Theodor verbot 1789 Beerdigungen innerhalb der Stadtmauern. Zu diesem Zeitpunkt war der Alte Südliche Friedhof vor dem Sendlinger Tor der einzige Münchner Friedhof außerhalb der Stadt. Als er nicht mehr ausreichte, wurde 1866 bis 1869 in der Maxvorstadt der Alte Nordfriedhof (Alter Nördlicher Friedhof) nach Entwürfen des Stadtbaurats Arnold Zenetti errichtet.
Neue Gräber wurden ab 1939 nicht mehr angelegt. Der Architekt Hans Döllgast (1891 – 1974) gab dem Friedhof Anfang der Fünfzigerjahre die heutige Form.

Mehr über den Alten Nördlichen Friedhof im Album über die Maxvorstadt
Garten der Kunstakademie
Max Kolb (1829 – 1915), der Vater der Schriftstellerin Annette Kolb, gehörte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu den erfolgreichsten Gartenarchitekten Europas. 1869 übernahm er die Oberleitung der städtischen Grünanlagen in München. In dieser Funktion plante er 1886 den Garten auf der Rückseite der 1876 bis 1886 von Gottfried von Neureuther (1811 – 1887) errichteten Königlich-Bayerische Akademie der Bildenden Künste in München.
Album über die Akademie der Bildenden Künste München
Schwabing-West
Münchner Stadtbezirk 4: Schwabing-West
Bayernplatz
Auf dem 1911 angelegten Bayernplatz (Bayernpark) in Schwabing steht seit 1979 die von Undine Werdin aus Steinguss geformte Statue Daphne.

Luitpoldpark
1909 beschloss der Münchner Magistrat, zu Ehren des Prinzregenten Luitpold einen Park anzulegen, und die 90. Linde wurde dann auch 1911 zur Feier des 90. Geburtstags Luitpolds von Bayern gepflanzt. Die Bildhauer Heinrich Düll* und Georg Pezold* gestalteten den Obelisken im Luitpoldpark.
*) Mehr zu Heinrich Düll und Georg Pezold im Album über Kunst im öffentlichen Raum




Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand am Nordostrand des Luitpoldparks der 37 Meter hohe Schwabinger Schuttberg, der 1957 bis 1960 landschaftlich gestaltet wurde und seither Luitpoldhügel heißt.







Au
Münchner Stadtbezirk 5: Au-Haidhausen
Frühlingsanlagen
Die Frühlingsanlagen in der Au erstrecken sich am rechten Ufer der Isar gegenüber der Weideninsel zwischen der → Wittelsbacher- und der → Reichenbachbrücke.
Isaranlagen
Auen, Kiesbänke und Bademöglichkeiten im sauberen Wasser der Isar bilden ein Freizeit- bzw. Naherholungsgebiet in München, das auf beiden Ufern mit Spazier-, Wander- und Fahrradwegen sehr gut erschlossen ist.




Album über die Isar
Haidhausen
Münchner Stadtbezirk 5: Au-Haidhausen
Weißenburger Platz
Auf dem Weißenburger Platz in Haidhausen steht ein 1853 von dem Architekten August von Voit entworfener, von dem Bildhauer Anselm Sickinger und dem Steinmetz Nikolaus Höllriegel gebauter Brunnen, der damals im Glaspalast im → Alten Botanischen Garten aufgestellt wurde. Von 1901 bis 1971 plätscherte er auf dem → Orleansplatz, seit 1974 markiert er das Zentrum des Weißenburger Platzes.



Bordeaux-Platz
Im Unterschied zu anderen Plätzen und Straßen im Haidhauser Franzosenviertel wurde der Bordeaux-Platz nicht nach Orten benannt, an denen im Krieg 1870/71 deutsche über französische Truppen gesiegt hatten, sondern nach einer Münchner Partnerstadt.
Der 1998 neu gestaltete Bordeaux-Platz wird von Häusern aus der Gründerzeit, einer Lindenallee und einer Hainbuchenhecke umrahmt. Im Zentrum befindet sich seit 1929 ein Brunnen mit von den Bildhauern Alfred Keller und Hermann Seibel gestalteten Figuren jagdbarer Tiere aus Muschelkalk: Eber und Widder, Rehbock und Steinbock.


Maximiliansanlagen
König Maximilian II. ließ 1857 bis 1866 die später (1897) nach ihm benannten Anlagen vom Hofgärtner Carl von Effner (1831 – 1884) anstelle einer Schafweide am Isarhochufer anlegen. Der Gartenarchitekt Jakob Möhl (1846 – 1916) erweiterte die Maximiliansanlagen 1891 bis 1893. Sie erstrecken sich entlang der Isar in Haidhausen und Bogenhausen zwischen dem → Gasteig und der → Max-Joseph-Brücke. Die → Prinzregentenstraße teilt die Maximiliansanlagen am → Friedensengel in eine südliche und eine nördliche Hälfte.
Album über die Maximiliansanlagen
Sendling
Münchner Stadtbezirk 6: Sendling
Flaucheranlagen
Der Abschnitt zwischen der → Thalkirchner Brücke und der Braunauer Eisenbahnbrücke wurde nach der Gastwirtschaft »Zum Flaucher« benannt, die der Wirt Johann Flaucher um 1870 in einem damals etwa 70 Jahre alten Forsthaus in den Isarauen eröffnet hatte. Die Parkanlagen entstanden in den Fünfzigerjahren. Heute sind der Flaucher und die Flaucheranlagen ein beliebtes Naherholungsgebiet.











Album über die Isar
Sendlinger Park
Der Sendlinger Park mit dem Neuhofener Berg gehört zu den Grünanlagen am Isarhochufer. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand an diesem Ort einer der drei großen Schuttberge aus den Trümmern der zerbombten Gebäude in München. (Die beiden anderen: → Luitpoldhügel und → Olympiaberg.)





Die um 1932 von dem Bildhauer Emil Krieger* (1902 – 1979) geschaffene, im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Skulptur »Isis, schwimmend auf den Wellen« befand sich ursprünglich am Possartplatz (→ Shakespeareplatz) in Bogenhausen. Heute »schwimmt« sie auf einer Wiese im Sendlinger Park.
*) Mehr zu Emil Krieger im Album über Kunst im öffentlichen Raum


Sendling-Westpark
Münchner Stadtbezirk 7: Sendling-Westpark
Südpark
1969/70 gestaltete man den Sendlinger Wald mit Spazierwegen zum heutigen Südpark um. Inzwischen gibt es dort auch Liegewiesen, Spielplätze, Tischtennisplatten und mehr.







Westpark
1976 schrieb die Stadt München einen Architektenwettbewerb für die Anlage eines neuen Parks – des Westparks – auf einem fast unbebauten Brachland im (1992 aufgelösten) Waldfriedhofviertel aus. Der Entwurf des Münchner Landschaftsarchitekten Peter Kluska (1938 – 1920) überzeugte die Jury Anfang 1977.
Parallel dazu bewarb sich München im Mai 1977 für die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 1983 – und erhielt im Juli den Zuschlag. So entstand von 1978 bis 1983 der zweieinhalb Kilometer lange, 69 Hektar große Westpark mit künstlichen Hügeln und zwei Seen. Dabei pflanzte man nicht nur 100.000 Sträucher, sondern auch mehr als 6000 zwanzig bis vierzig Jahre alte Bäume ein.
Rechtzeitig zur Internationalen Gartenbauausstellung, die vom 28. April bis 9. Oktober 1983 im Westpark stattfand, wurde außerdem die U-Bahn-Linie 6 vom Harras bis zum Westpark und zum Bahnhof Holzapfelkreuth verlängert (→ »Blumenlinie«).
Im Westpark gibt es auch einige Kunstwerke, einen Rosengarten, das Bayerwald- und das Sardenhaus, dazu ein Ostasien-Ensemble mit Thailändischer Sala, eine nepalesischer Pagode, einem China- und einem Japangarten.




Album über den Westpark
Album über die Kirschblüte in München
Schwanthalerhöhe
Münchner Stadtbezirk 8: Schwanthalerhöhe
Bavariapark
König Ludwig I. ließ 1825 bis 1831 von seinem Hofgärtner Ludwig Karl Seitz den »Theresienhain« anlegen. Seit der Aufstellung der »Bavaria« heißt die Anlage »Bavariapark«. Öffentlich zugänglich wurde der Park 1872.


Gollierplatz
Der 200 Meter lange und 50 Meter breite Gollierplatz auf der Schwanthalerhöhe trägt seit Ende des 19. Jahrhunderts den Namen einer ab 1269 nachweisbaren, aber vermutlich schon 1318 erloschenen Patrizierfamilie Münchens (Gollir, Gollier). Dementsprechend wird »Gollier« nicht französisch ausgesprochen (übrigens ebenso wenig wie der Name der Münchner Bäckerei Rischart).

Neuhausen-Nymphenburg
Münchner Stadtbezirk 9: Neuhausen-Nymphenburg
Hirschgarten
Der Hirschgarten im Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg geht auf eine 1720 angelegte Fasanerie zurück. Von 1767 bis 1786 wurde dort für die kurfürstlichen Brauhäuser Hopfen angebaut. 1780 beauftragte Kurfürst Karl Theodor seinen Oberstjägermeister Johann Theodor Freiherr von Waldkirch, Wild auf dem Gelände auszusetzen und ein Jagdrevier anzulegen. Das war zunächst für den Adel reserviert, wurde aber bald schon öffentlich zugänglich.
1958/59 gestaltete man den nordöstlichen Teil des Geländes zum Naherholungsgebiet um, und 1968 bis 1970 erweiterte man die öffentliche Parkanlage nach Süden. Zu den Attraktionen des Hirschgartens gehört ein Wildgehege.
Im Nordwesten des Parks befindet sich der größte Biergarten der Welt. 8000 Gäste haben im »Königlichen Hirschgarten« Platz, 1000 mehr als am Chinesischen Turm und 3000 mehr als im Augustiner Keller.






Grünwaldpark
Wo früher die Kutschen zwischen der → Münchner Residenz und → Schloss Nymphenburg fuhren, gab es eine Gaststätte »Grünwaldpark«. Daran erinnert heute noch der Grünwaldpark zwischen Südlicher Auffahrtsallee, Waisenhausstraße und Nymphenburger Straße. Spazierwege führen vom Grünwaldpark bzw. vom → Hubertusbrunnen am → Schlosskanal entlang nach Westen.

Schlosspark Nymphenburg
Der bayrische Kurfürst Ferdinand Maria erwarb 1663 ein Areal östlich des → Schlosses Blutenburg und ließ dort 1664 bis 1675 für seine Gemahlin Henriette Adelheid von Savoyen ein Landschloss errichten, dem sie den Namen »Nymphenburg« gab. Es war ein Geschenk für sie, weil sie einen Thronfolger geboren hatte.
Unter Kurfürst Max II. Emanuel wurde 1701 der Grundstein für die Erweiterung des Anwesens zur barocken Schlossanlage durch Enrico Zuccalli und Giovanni Antonio Viscardi gelegt. 1715 begannen Dominique Girard und Joseph Effner, den Schlossgarten zu erweitern und ein Kanalsystem zu bauen, um Wasser von der Würm heranzuführen. Kurfürst Karl Theodor öffnete den Nymphenburger Park fürs Volk. Der Gartenbaudirektor Friedrich Ludwig Sckell (1750 – 1823), der 1777 im Schwetzinger Schlossgarten einen französischen Barockgarten und englischen Landschaftspark harmonisch verbunden hatte, schuf 1804 bis 1807 den südlichen Landschaftsgarten in Nymphenburg, 1810 bis 1823 den nördlichen. Das barocke Parterre behielt er bei. Der unter Denkmalschutz stehende und als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Nymphenburger Schlosspark gilt als eines der größten und bedeutendsten Gartenkunstwerke Deutschlands.












Album über den Schlosspark Nymphenburg
Botanischer Garten München
Friedrich Ludwig von Sckell gestaltete 1812 einen Botanischen Garten in München (→ Alter Botanischer Garten). Karl Eberhard von Goebel, der Direktor des Botanischen Gartens von 1891 bis 1932, initiierte die Verlegung und Neuanlage nördlich des Schlossparks Nymphenburg, die von 1909 bis 1914 realisiert wurde. Mit dem Garteningenieur Peter Holfelder gemeinsam war Ludwig Ullmann für das Konzept der Gartenanlage verantwortlich.
Anfangs dienten Botanische Gärten wissenschaftlichen Zwecken. Heute sieht der Botanische Garten in München seine wichtigste Aufgabe darin, einen Ort nicht nur der Bildung, sondern auch der Erholung zu pflegen.




Album Botanischer Garten
Moosach
Münchner Stadtbezirk 10: Moosach
Zwischen Kapuzinerhölzl und Westfriedhof
Beim Kapuzinerhölzl an der südwestlichen Ecke des Stadtbezirks Moosach handelt es sich um Eichen-Hainbuchenwald mit bis zu 200 Jahre alten Bäumen. Es ist der Rest eines Lohwaldes, der dem Kapuzinerkloster St. Anton in München gehörte und die Stadt jahrhundertelang im Norden und Westen umgab. Seit 1964 ist das Areal Teil des Landschaftsschutzgebiets Kapuzinerhölzl und Hartmannshofen.
Schöne Spazierwege führen vom Kapuzinerhölzl in Moosach zum südwestlichen Eingang des Westfriedhofs.






Westfriedhof
Hans Grässel (1860 – 1939), der sich vor allem als Schul- und Friedhofsarchitekt einen Namen machte, gestaltete 1897 bis 1902 die Bebauung des 1898 eröffneten Friedhofs im Süden von Moosach im frühchristlichen Stil. Als »Westfriedhof« fiel die Anlage an München, noch bevor die Gemeinde Moosach 1913 ein Stadtteil wurde.




Milbertshofen-Am Hart
Münchner Stadtbezirk 11: Milbertshofen-Am Hart
Panzerwiese
Ganz im Norden des Stadtbezirks Milbertshofen-Am Hart befindet sich die Panzerwiese, die bis Ende der Achtzigerjahre als militärisches Übungsgelände diente. 2002 wurde das 280 Hektor große Gelände (einschließlich Hartelholz) zum Naturschutzgebiet erklärt. Darauf steht die Ruine eines ehemaligen Militärgebäudes, die Münchner Panzermauer. Über die Panzerwiese und die Südliche Fröttmaninger Heide hinweg blickt man auf die Allianz-Arena und den Fröttmaninger Berg.



Hartelholz
Der Wald Hartelholz nördlich der Panzerwiese ist Teil des Münchner Grüngürtels. Unter Herzog Wilhelm V. gehörte das Areal zu Schleißheim und wurde als herzogliches Jagdrevier genutzt.

Olympiapark
Als 1966 die Entscheidung gefallen war, die XX. Olympischen Sommerspiele 1972 in München auszutragen, wurde ein Areal im Norden der Stadt dafür vorbereitet. Auf dem Oberwiesenfeld in Milbertshofen, wo sich von 1925 bis 1938 der erste bayrische Verkehrsflugplatz befunden hatte, arbeiteten nach der Grundsteinlegung am 14. Juli 1969 bis zu 8000 Menschen, um ein fast drei Quadratkilometer großes Sport- und Erholungsgelände zu gestalten.
Das »demokratische Grün« des Olympiaparks wurde von dem Landschaftsarchitekten Günther Grzimek (1915 – 1996) gestaltet. Die zu einem 60 Meter hohen Schuttberg zusammengetragenen Trümmer aus dem Zweiten Weltkrieg verschwanden unter dem Rasen des »Olympiabergs«, und der Olympiasee entstand durch Aufstauung des Nymphenburg-Biedersteiner Kanals. Der Olympiapark gehört zu den größten Grünanlagen in München.





Sapporo, wo im Februar 1972 die Olympischen Winterspiele stattfanden, schenkte der Partnerstadt München anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 eine Reihe von Kirschbäumen, die auch noch ein halbes Jahrhundert später im Olympiapark prächtig blühen und an Hanami denken lassen.







Album über den Olympiapark
Album über die Kirschblüte in München
Olympiadorf
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München baute man neben dem Olympiapark Unterkünfte: das Olympiadorf. Die Entwürfe für die nach den Spielen als Trabantenstadt konzipierte Anlage stammten von dem Stuttgarter Architekturbüro HW&P (Erwin Heinle, Robert Wischer und Partner). Der Brite Cedric Price war einer der maßgeblich Beteiligten. 1998 wurde das Olympiadorf ebenso wie die Sportanlagen im Olympiapark unter Ensembleschutz gestellt. Eine »Betonwüste«? Allenfalls in einigen Bereichen. Die ungewöhnliche Wohnanlage wirkt frappierend gut durchdacht und bietet nicht nur überraschend viel Grün, sondern sogar einen Badesee.






Album übers Olympiadorf
Petuelpark
Über dem 1995 bis 2002 gebauten Petueltunnel des Petuelrings an der Grenze zwischen Schwabing und Milbertshofen wurde 2004 ein Park angelegt und ebenfalls nach Angehörigen der Familie Petuel benannt.




Album über den Petuelpark
Album über die Kirschblüte in München
Ricarda-Huch-Straße, Christoph-von-Gluck-Platz, Oberhofer Platz …
Eine schmale Grünanlage in Milbertshofen erstreckt sich vom westlichen Ende des Petuelparks im Süden bis zum Oberhofer Weg nördlich des Frankfurter Rings.
Grünanlage in Milbertshofen (Fotos: April / Oktober 2025)
Schwabing-Freimann
Münchner Stadtbezirk 12: Schwabing-Freimann
Leopoldpark
Prinz Leopold Maximilian von Bayern (1846 ‒ 1930) ließ bei einem von seiner Gemahlin Gisela seit 1873 bewohnten Palais in Schwabing einen Park anlegen. Das Gebäude wurde 1935 von der NSDAP abgerissen. Reste des Leopoldparks blieben erhalten und wurden in den Siebzigerjahren neu angelegt.

Schwabinger See
Der Schwabinger See wurde Ende der Achtzigerjahre auf dem Gelände des 1987 aufgelassenen Schwabinger Güterbahnhofs angelegt. Durchflossen wird er vom Nymphenburg-Biedersteiner Kanal (»Schwarze Lacke«), der im Englischen Garten in den Schwabinger Bach mündet. Ein Kilometer nördlich des Schwabinger Sees ragen die 2004 fertiggestellten »Highlight Towers« 113 bzw. 126 Meter hoch auf.




Biedersteiner Freizeitpark
Nach dem Bau des Biedersteiner Tunnels in Schwabing – eines 300 Meter langen Abschnitts des Mittleren Rings ‒ wurde 1967 darüber und südlich davon der Biedersteiner Freizeitpark angelegt (der sehr viel kleiner ist als der frühere Park Biederstein).









Englischer Garten
Auf Anregung des in Massachusetts geborenen bayerischen Kriegsministers Benjamin Thompson – ab 1792: Reichsgraf von Rumford – ordnete Kurfürst Karl Theodor im Februar 1789 die Anlage von Militärgärten in bayerischen Garnisonsstädten an. In München wurde damit im Juli 1789 begonnen, und im folgenden Monat beschloss Karl Theodor, östlich davon einen Park anzulegen, der »dem ganzen Volke zugute kommen« sollte.
Der Hofgärtner Friedrich Ludwig von Sckell (1750 ‒ 1823) orientierte sich bei der Gestaltung nicht an geometrischen Barockgärten, sondern an der Natur. Der »Englische Garten« wurde im Frühjahr 1792 seiner Bestimmung übergeben.
Oberst Reinhard Freiherr von Werneck (1757 – 1842), der den Grafen Rumford 1798 als Direktor des Englischen Gartens in München ablöste, erweiterte den Park nach Norden, bis Friedrich Ludwig von Sckell 1804 Hofgartenintendant in München wurde.
Heute ist der seit dem Bau des Isarrings Mitte der Sechzigerjahre in einen Süd- und einen Nordteil geteilte Englische Garten eine der größten innerstädtischen Parkanlagen der Welt. Er übertrifft sowohl den Hyde Park in London als auch den Central Park in New York. Und der Englische Garten geht auch noch im Süden in die → Maximiliansanlagen, den → Hofgarten und den → Finanzgarten über. Damit bildet der Englische Garten eine »Grüne Lunge«.
Die Gesamtlänge der Wege durch die Gehölz-, Wiesen- und Wasserflächen des Englischen Gartens beträgt knapp 80 Kilometer. Mehr als hundert Brücken ermöglichen das Überqueren der Bäche. Pro Jahr werden fünf Millionen Menschen im Englischen Garten gezählt. Sie hinterlassen 120 Tonnen Müll.
Der Englische Garten beginnt an der Prinzregentenstraße im Lehel, aber der größte Teil – nördlich der Bus-Trasse – mit dem Kleinhesseloher See und der Hirschau gehört zum Stadtbezirk Schwabing-Freimann.




Album über den Englischen Garten
Fröttmaninger Berg
1954 wurde neben dem Dorf Fröttmaning die Deponie Großlappen eröffnet. Ein Großbrand zerstörte die Müllsortieranlage 1965, aber der Betrieb ging bis 1987 weiter. 1973 begann man mit einer Renaturierung des 75 Meter hohen Müllbergs. Inzwischen ist aus dem »Fröttmaninger Berg« eine Parklandschaft geworden.


Auf dem Gipfel dreht sich seit 1999 die Windkraftanlage Fröttmaning, die älteste der Stadt München. Vom »Fröttmaninger Berg« sieht man nicht nur auf die Allianz Arena, sondern auch auf die 2020 gebaute zweite Windkraftanlage der Stadtwerke München.




Fröttmaninger Heide
Die Fröttmaninger Heide war von Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts ein Militärgelände. Heute gilt das von der A99 durchschnittene Areal als größte noch erhaltene Fluss-Schotterheide Süddeutschlands und eine der größten zusammenhängenden Grasheiden Mitteleuropas.


Freimanner Heide
Die Freimanner Heide bzw. der Carl-Orff-Bogen-Park beginnt in der Gartenstadt Heidemannstraße und geht im Norden in die Südliche Fröttmaninger Heide über.


Bogenhausen
Münchner Stadtbezirk 13: Bogenhausen
Shakespeareplatz
Der spätere Stadtgartendirektor Otto Multerer (1880 – 1958) gestaltete 1913 eine Grünanlage in Bogenhausen, die zunächst Holbein- bzw. Possartplatz hieß und seit 1964 den Namen Shakespeareplatz trägt. Zu William Shakespeare passt die → Bronzestatue der Julia Capulet (»Romeo und Julia«), bei der es sich ebenso wie bei der am Alten Rathaus um eine Kopie der von Nereo Costantini (1905 – 1969) für das Capulethaus in Verona geschaffenen Originalskulptur handelt.

Herzogpark, Herzog-Albrecht-Anlage
Der nach dem bayrischen Herzog Albrecht IV. (1447 – 1508) benannte Park, die Herzog-Albrecht-Anlage, entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts parallel zum Villenviertel Herzogpark.




Von der Herzog-Albrecht-Anlage braucht man nur ein paar Schritte zu gehen, dann ist man im Park des Stadtviertels Herzogpark, der sich von der → Herzogparkstraße im Südwesten nach Nordosten bis zum Grüntal auf Höhe des → Stauwehrs Oberföhring erstreckt, großenteils am → Brunnbach entlang.
Max-Halbe-Weg
Vom → Stauwehr Oberföhring führt der Max-Halbe-Weg in Bogenhausen nach Osten zur Mauerkircherstraße.

Isarinsel Oberföhring
Zwischen der Isar und dem am → Stauwehr Oberföhring ausgeleiteten Mittleren Isarkanal befindet sich eine 1977 ‒ 1979 angelegte bewaldete Grünanlage mit Spazierwegen, die bis zum → Poschinger Weiher in Unterföhring führen.

Spazierweg entlang der Isar in der Grünanlage »Isarinsel Oberföhring« (Fotos: September 2024 / Mai 2025)
Grüngürtel in Bogenhausen-Priel
Der → Priel in Bogenhausen wird von einem Grüngürtel durchzogen, der im Osten mit der Grünanlage Wahnfriedallee beginnt und bis zum Rienziplatz reicht. Dazu gehören auch der Odinpark und der Tannhäuserpark.








Salzsenderweg
Der Salzsenderweg an der Grenze zwischen Oberföhring, Johanneskirchen und Englschalking wurde 1989 angelegt, ungefähr auf der Trasse des von den Römern mit Schotter aufgeschütteten Damms, der bis zur Gründung Münchens (1158) als Salzhandelsstraße von Salzburg über die Föhringer Isarbrücke nach Augsburg benutzt wurde. Darauf verweisen zwei Säulen, die wie römische Meilensteine aussehen.
Salzsenderweg (Fotos: Juni 2025)
Normannenplatz
1925 erhielt der Normannenplatz in Bogenhausen seinen Namen – nach den Normannen, Nachkommen der Wikinger im Fränkischen Reich, die sich zum Christentum bekehrten. Es handelt sich um eine schmale Grünanlage zwischen Englschalkinger Straße, Normannen-, Teutonen-, Vandalen-, Muspelheim- und Odinstraße.

Ökologisches Bildungszentrum, Englschalkinger Anger
2001 eröffneten die Münchner Volkshochschule und das Münchner Umwelt-Zentrum das Ökologische Bildungszentrum in Bogenhausen, an der südlichen Grenze von Englschalking. Von den frei zugänglichen Gärten des ÖBZ an der Englschalkinger Straße 166 bis zur Eggenfeldener Straße bzw. zum → Denninger Anger reichen die Parkanlagen auf einem Areal, das bis in die Achtzigerjahre für eine Trambahntrasse vorgesehen war (»Englschalkinger Anger«).



Denninger Anger
Beim Denninger Anger handelt es sich um eine 20 Hektar große Grünanlage in Bogenhausen, Denning und Zamdorf. Der älteste Teil entstand bereits in den Sechzigerjahren. In den Achtzigerjahren wurde das Gelände zu einem hügeligen Stadtpark mit geschwungenen Spazierwegen erweitert.










Zamilapark
Josef Schörghuber (1920 – 1995) baute parallel zum → Arabellapark 1983 bis 1991 auch die Siedlung »Zamilapark« in Zamdorf. Man warf ihm vor, er habe die Grundstücke von der Stadt München unter Wert kaufen können (»Zamdorfer Grundstücksaffäre« 1984). Seinen Namen erhielt der Zamilapark nach der Zamilastraße, die seit 1956 so heißt. Während sich der Ortsname Zamdorf von dem Männernamen Zamo ableitet, griff man mit Zamilastraße und -park auf den Frauennamen Zamila zurück.







Berg am Laim
Münchner Stadtbezirk 14: Berg am Laim
Zwieselbergweg
In München gibt es zahlreiche Parks und Grünflächen, oft auch lange schmale Grünstreifen. So kann man beispielsweise knapp zwei Kilometer weit vom Hüllgraben in Berg am Laim bis zur Bajuwarenstraße in Trudering im Grünen gehen, von der St.-Veit-Straße bis zur Rofanstraße auf dem Zwieselbergweg.

Trudering-Riem
Münchner Stadtbezirk 15: Trudering-Riem
Truderinger Wald
Von der Endhaltestelle der Buslinie 194 (Nauestraße) lassen sich Spaziergänge durch den Truderinger Wald unternehmen. Das Biotop in der renaturierten Kiesgrube – Grubenpark – ist inzwischen allerdings ausgetrocknet.






Bajuwarenpark
Der Bajuwarenpark in Trudering wurde 2008 über einer zweieinhalb Jahrtausende alten keltischen Siedlung errichtet. Darauf weisen Informationstafeln an Granitblöcken hin. Im Westen wird die Grünanlage von der Straße begrenzt, die seit 2006 den Namen von Marianne Plehn (1863 – 1946) trägt. Die auf Fischpathologie spezialisierte Biologin aus Westpreußen erhielt 1910 von der Königlichen Tierärztlichen Hochschule München (heute: Tiermedizinische Fakultät der LMU) eine Ehrenpromotion, und König Ludwig III. von Bayern verlieh ihr 1914 den Professorentitel. Damit wurde sie die erste Professorin in Bayern.
Bajuwarenpark (Fotos: Juni 2025)
Riemer Park
Der Riemer Park entstand nach Plänen des französischen Landschaftsarchitekten Gilles Vexlard (Büro Latitude Nord, Paris) für die Bundesgartenschau in München vom 28. April bis 9. Oktober 2005. Während beim Ostpark, Westpark und Olympiapark in München ebenso wie beim → Denninger Anger hügelige Landschaften angelegt wurden, machte Gilles Vexlard das Gegenteil: der Riemer Park ist von schnurgeraden Linien durchzogen. Nur der See und einige wenige Flächen fügen sich nicht in die Symmetrie.


Mehr über den Riemer Park im Album über Trudering-Riem
Ramersdorf
Münchner Stadtbezirk 16: Ramersdorf-Perlach
Grünanlage an der Wilramstraße
Williram von Ebersberg (vor 1010 – 1085) stammte aus einer mittelrheinischen Adelsfamilie. Von 1048 bis zu seinem Tod leitete er das Benediktinerkloster Ebersberg als Abt. In seinem Hauptwerk (»Expositio in cantica canticorum«) stellte er in drei Spalten neben den lateinischen Bibeltext eine althochdeutsche Übersetzung und einen Kommentar. Seit 1908 trägt die Wilramstraße in Ramersdorf seinen Namen.
Südlich der Wilramstraße verläuft eine Grünanlage, die sich im Westen bis zum nach der Frauenrechtlerin Sophia N. J. Goudstikker (1865 – 1924) benannten S. Goudstikker Park fortsetzt und im Süden einen namenlosen Ausläufer bis zur Chiemgaustraße hat.



Perlach
Münchner Stadtbezirk 16: Ramersdorf-Perlach
Neuer Südfriedhof
Der Neue Südfriedhof an der Hochäckerstraße in Perlach wurde 1977 vom Garten- und Landschaftsarchitekten Gottfried Hansjakob (*1937) angelegt. Das mehr als 35 Hektar große Gelände wirkt nicht zuletzt wegen des Sees mehr wie ein Park.
















Zwischen Ostpark und Neuem Südfriedhof
Mit Ausnahme einer 400 Meter langen Strecke auf der Unterhachinger Straße kann zwischen Ostpark und → Neuem Südfriedhof durch Grünanlagen gehen, zum Beispiel östlich der Straße Am Graben.

Ostpark
1962 beschloss die Stadt München, eine Trabanten- bzw. Entlastungsstadt zu bauen: Neuperlach. Zu diesem Projekt gehörte dann auch ein 1965 vom Landschaftsarchitekten Ludwig Roemer (1911 – 1974) konzipierter Park, der bis 1982 angelegt wurde. Den See im Ostpark gestaltete der Gartenarchitekt Josef Wurzer. (Mehr dazu im Album über den Ostpark.)






Frühling im Ostpark (Fotos: 8. April 2025)


Album über den Ostpark
Grünanlage parallel zum Karl-Marx-Ring
Parallel zum Karl-Marx-Ring 1 ‒ 61 und entlang der Grenze zwischen Neuperlach und Truderingverläuft eine Grünanlage mit Spazierwegen, Spiel- und Sportplätzen.







Perlachpark
Der Gustav-Heinemann-Ring, der den Perlachpark an zwei Seiten umschließt, erinnert seit 1985 an Gustav Heinemann (1899 – 1976), den dritten Bundespräsidenten (1969 – 1974).

Der Künstler Albert Hien (*1956), der bereits 1990 die beiden → Brunnen auf dem Gelände der GEMA neben dem Kulturzentrum → Gasteig in Haidhausen gestaltet hatte, schuf 1992 einen ungewöhnlichen Brunnen im Perlachpark: »Objekt im See«. Im eingeschalteten Zustand spritzt Wasser aus dem einen Teil in die tütenförmige Öffnung des anderen.




Echopark
Die Grünanlage am Max-Rheinhardt-Weg in Neuperlach ist auch als Echopark bekannt.

Im Gefilde
Das Büro »ver.de landschaftsarchitektur« in Freising gewann Ende 2002, zwei Jahre nach der Gründung, einen Wettbewerb für die Gestaltung eines Grünzugs im Osten von Neuperlach: »Im Gefilde«. Die Landschaftsarchitekten realisierten ihre Entwürfe und stellten den südlichen Teil des 21 Hektar großen Parks 2007, den nördlichen mit einer Reihe von Sportanlagen 2012 fertig.

Obergiesing
Münchner Stadtbezirk 17: Obergiesing-Fasangarten
Walchenseeplatz
Nach einem Entwurf Walther von Hattingbergs goss Cosmas Leyrer 1930 die Bronzefigur eines Buben, die im Jahr darauf als Brunnenfigur am Walchenseeplatz aufgestellt wurde: »Brunnenbuberl-Brunnen«.


Weißenseepark
Der in den Achtzigerjahren angelegte – nach dem Weißensee im Allgäu benannte ‒ Park in Obergiesing wurde 2009/10 im Rahmen eines Bund-Länder-Städtebauförderprogramms neu gestaltet, und 2015/16 eröffnete man im südlichen Teil des Parks, dem Katzenbuckel, einen weiteren Spielplatz. Die Findlinge im Weißenseepark erinnern daran, dass das Gelände früher zur Giesinger Kiesgrube gehört hatte.
Spielplatz am Katzenbuckel im Weißenseepark (Fotos: März 2024 / August 2025)
Friedhof am Perlacher Forst
Der Friedhof am Perlacher Forst in Obergiesing wurde im Jahr 1931 nach Plänen des Stadtbaurats Hermann Leitenstorfer (1896 – 1972) angelegt.








Lindenalleen im Friedhof am Perlacher Forst (Fotos: August 2025)
Untergiesing-Harlaching
Münchner Stadtbezirk 18: Untergiesing-Harlaching
Tierpark Hellabrunn
Kurfürst Maximilian III. ließ 1770 ein Gehege für wilde Tiere im Nymphenburger Park anlegen. Und in der ersten Hälfte der Sechzigerjahre des 19. Jahrhunderts soll vorübergehend ein Zoo am Rand des Englischen Gartens existiert haben. Oberstleutnant Hermann Manz (1853 ‒ 1924) setzte sich im Ruhestand für die Gründung eines Tierparks ein und gehörte 1905 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins »Zoologischer Garten München«. Der Tierpark Hellabrunn konnte zwar 1911 in den Isarauen nordöstlich der Thalkirchner Brücke eröffnet werden, aber nach elf Jahren musste er aus finanziellen Gründen wieder schließen.
Bei der Neueröffnung des Zoologischen Gartens im Mai 1928 griff Heinz Heck, der den Tierpark Hellabrunn bis 1964 leitete, Ideen von Carl Hagenbeck auf und richtete den ersten Geozoo der Welt ein, das heißt, er orientierte sich bei der Anordnung der Tierarten an ihrer geografischen Herkunft. Dieses Konzept wird inzwischen durch das der Biodiversität ergänzt.
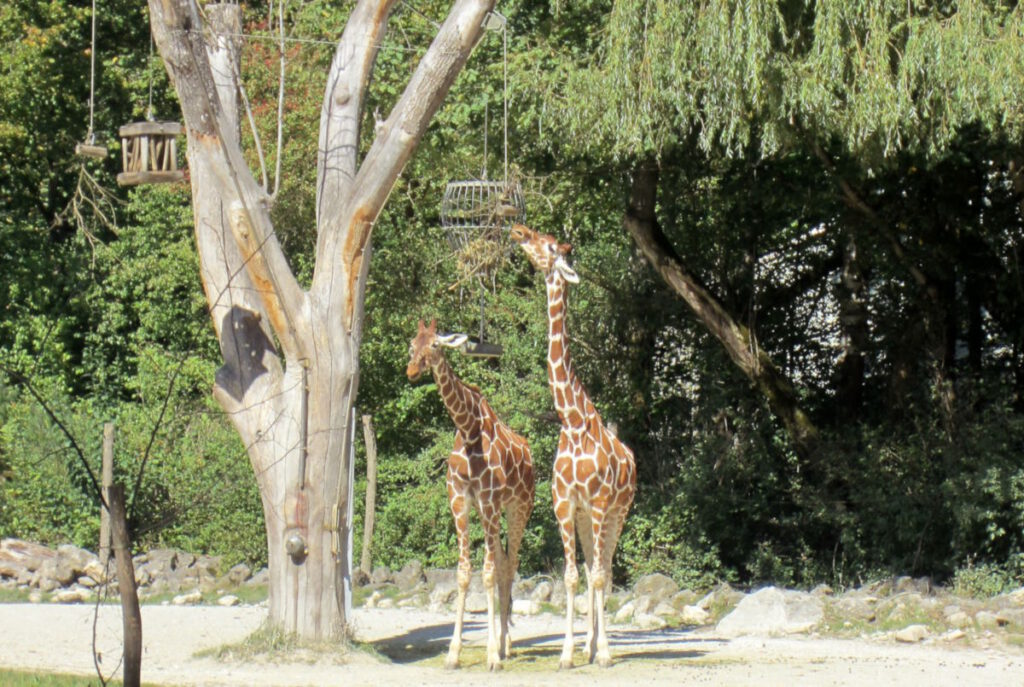

Album zum Tierpark Hellabrunn
Isarauen




Album über die Isar
Rosengarten
Der Rosengarten (»Schaugärten an der Sachsenstraße«) in den Isaranlagen ging 1955 aus der 1901 vom damaligen Stadtgartendirektor Jakob Heiler eingerichteten Städtischen Baumschule Bischweiler hervor.


Album über den Rosengarten
Hochleite
Der drei Kilometer lange Weg entlang der oberen Kante des Abhangs (Leite) am Isarhochufer trägt den Namen Hochleite. Es handelt sich dabei um einen schattigen Spazierweg und einen parallel dazu verlaufenden Radfahrweg zwischen Harlaching und Grünwald. Mit Autos befahrbar ist nur ein kurzer Abschnitt im Norden, vor der Einmündung der Hochleite in die Lindenstraße.


Grünanlage Kuntersweg
Vom St.-Quirin-Platz (U-Bahn) kann man knapp zwei Kilometer durch Grünanlagen (Am Hohen Weg, Kuntersweg) zum Tiroler Platz (Trambahn) laufen.



Vollmarpark
Der Vollmarpark in Neuharlaching erinnert seit 1945 an Georg von Vollmar (Georg Carl Joseph Heinrich Ritter von Vollmar auf Veltheim, 1850 – 1922), der um 1890 entscheidend am Aufbau eines bayrischen Landesverbands der SPD mitwirkte und von 1894 bis 1918 als Landesvorsitzender der SPD in Bayern amtierte.





Athener Platz
Seit 1910 trägt der Athener Platz in Harlaching den Namen der griechischen Hauptstadt. Dort hatte Otto von Wittelsbach (1815 – 1867) von 1834 bis 1862 als erster König des nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen das Osmanische Reich gegründeten und 1830 international anerkannten Staates Griechenland residiert. (1832 bis 1834 war Nauplia die Hauptstadt gewesen.)
Die Parkanlage mit einer Grünfläche und einer Lindenallee entstand 1932.


Thalkirchen
Münchner Stadtbezirk 19: Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln
Isarauen


Album über die Isar
Obersendling
Münchner Stadtbezirk 19: Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln
Siemenspark, Siemenswäldchen
Nach dem Zweiten Weltkrieg zog Siemens von Berlin nach München, und Obersendling wurde »Siemensland«. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Siemens-Gelände in Obersendling und die in der Siemens-Siedlung Wohnenden legte Siemens ein nicht öffentliches Betriebssportgelände südlich der Siemensallee an (Hermann-von-Siemens-Sportpark). Nach der Jahrtausendwende gab Siemens den Standort auf und verkaufte die Liegenschaften. Die Sportanlage wurde 2011 nach einem halben Jahrhundert geschlossen.
2017 erwarb die Stadt München das Areal, und seit 2019 wurde es sukzessive öffentlich zugänglich. Im Siemenspark gibt es Spazierwege und Sportmöglichkeiten. Bemerkenswert ist der alte Baumbestand.







Öffentlich ist auch das Siemenswäldchen auf der anderen Seite der Siemensallee, zwischen der Allmannshausener Straße und dem ehemaligen Siemens-Geländes.

Hadern
Münchner Stadtbezirk 20: Hadern
Spazierwege am Stiftsbogen
Überquert man nahe des U-Bahnhofs und Einkaufszentrums Haderner Stern den Stiftsbogen, befindet sich links das Augustinum Neufriedenheim, rechts die Kurparksiedlung. Der Walter-Hopf-Weg führt zum Gondrellplatz jenseits der Autobahn. Kurz vor der Fußgängerbrücke über die Autobahn zweigt rechts ein namenloser Spazierweg zur Schröfelhofstraße ab. Folgt man dann der Maenherstraße und biegt in die Taeutterstraße ab, gelangt man auf einen Weg durch eine Grünfläche (Grünanlagen an der Kurparkstraße und am Stiftsbogen), der zurück zum Ausgangsort führt.
Der Walter-Hopf-Weg in Hadern zwischen Stiftsbogen und Autobahn erinnert seit 1972 an den CSU-Stadtrat Walter Hopf (1911 – 1969).


Die damalige Gotwinstraße wurde 1947 nach einem Münchner Ratsherrengeschlecht aus dem 14. Jahrhundert benannt: Maenherstraße.

Waldfriedhof
Der Architekt und Stadtbaumeister Hans Grässel (1860 – 1939) legte 1894 bis 1908 nacheinander den → Ostfriedhof (1894 – 1900), den → Nordfriedhof (1896 – 1899), den → Westfriedhof (1898 – 1902) und den → Neuen Israelitischen Friedhof (1904 – 1908) in München an. 1905 bis 1907 folgte im ehemaligen Hochwaldforst von Schloss Fürstenried der erste Waldfriedhof Deutschlands. 1963 bis 1966 erweiterte der Gartenarchitekt Ludwig Roemer (1911 – 1974) den Waldfriedhof nach Südwesten. Seither handelt es sich um den größten Friedhof in München: Vom Eingang Nord-Ost bis zum Ausgang Süd-West geht man 2,8 Kilometer weit.













Album über den Waldfriedhof
Pasing
Münchner Stadtbezirk 21: Pasing-Obermenzing
Pasinger Stadtpark, Paul-Diehl-Park
König Maximilian I. erwarb 1814 das Prinz-Carl-Schlösschen – den Vorgängerbau des heutigen Schlosses Gatterburg – auf einer Insel in der Würm und ließ dort 1815 einen Landschaftsgarten anlegen. 1929 entstand daraus ein Park der damals noch selbstständigen Stadt Pasing. Im Süden geht der Pasinger Stadtpark in den nach dem Lehrer, Filmemacher, Autor und Gräfelfinger Bürgermeister Paul Diehl (1886 – 1976) benannten Park über. Die Würm, die beide Parks durchfließt, ist an einigen Stellen zu künstlichen Seen aufgestaut. Von Nord nach Süd misst die gesamte Grünanlage etwas mehr als zwei Kilometer.


Untermenzing
Münchner Stadtbezirk 23: Allach-Untermenzing
Parkfriedhof Untermenzing
Der Friedhof Untermenzing (Eversbuschstraße 9a) entstand 1499 gleichzeitig mit dem Bau der → Kirche St. Martin. 1952 überbrückte man die Würm mit einem überdachten Holz-Steg und legte auf der westlichen Seite den sehr viel größeren Parkfriedhof Untermenzing an.


Hasenbergl
Münchner Stadtbezirk 24: Feldmoching-Hasenbergl
Frauenholz
Der Restwald nördlich der Siedlung Hasenbergl, südlich vom Korbinianiholz und westlich vom Hartelholz heißt Frauenholz. Der Name bezieht sich auf die Einsiedelei »Zu unserer lieben Frau«, in die sich Herzog Wilhelm V. von Bayern nach seiner Abdankung 1597 zurückgezogen hatte. (Das Gebiet gehörte bis 1962 zu Oberschleißheim.)
»Frauenholz« hieß auch ein 1937 auf dem Gelände der Fliegertechnischen Schule eingerichtetes Barackenlager. Nach dem Zweiten Weltkrieg wohnten dort bis 1953 »Displaced Persons«. Dann erwarb die Stadt München das Areal als Wohnanlage für 2000 Menschen. Beim Bau der Großsiedlung Hasenbergl in den Sechzigerjahren wurden die Baracken abgerissen.

Am Südwestrand des Waldes »Frauenholz« befindet sich ein Areal mit besonders windschief gewachsenen Kiefern.
Windschiefe Kiefern (Fotos: November 2025)
Feldmoching
Münchner Stadtbezirk 24: Feldmoching-Hasenbergl
»Dreiseenplatte«
Drei ab 1938 durch Kiesentnahme für die Anlage des Rangierbahnhofs Nord entstandene Baggerseen im Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl wurden Ende der Sechziger-, Anfang der Siebzigerjahre zu Erholungsgebieten umgestaltet: → Lerchenauer See, → Fasaneriesee, → Feldmochinger See. An allen drei Seen gibt es Rundwege, Grünanlagen, weitläufige Liegewiesen, Sport- und Bademöglichkeiten.





Mehr zu den drei Seen im Album über Feldmoching-Hasenbergl
Laim
Münchner Stadtbezirk 25: Laim
Park am Kärntner Platz
1925 wurde der Kärtner Platz in Laim nach dem südlichsten Bundesland Österreichs benannt. Nördlich des Kärtner Platzes und des Käthe-Bauer-Wegs in Laim befindet sich eine kleine Grünanlage ohne offizielle Bezeichnung.

Grünanlagen am Stadtrand von München
Erholungsgebiete zwischen Karlsfeld und Heimstetten
Die Großstadt München selbst verfügt über zahlreiche Parks und andere Grünanlagen. Mit dem öffentlichen Nahverkehr leicht erreichbar sind aber auch einige Erholungsgebiete außerhalb der Metropole, so zum Beispiel am → Karlsfelder See im Dachauer Moos, am → Poschinger Weiher oder am → Feringasee in Unterföhring. Vom Poschinger Weiher in Unterföhring kann man im Grünen ‒ an der Isar entlang und durch den Englischen Garten ‒ bis in die Altstadt (Lehel) laufen (8,5 km).


1969 begann der Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e. V. mit der Anlage von Liegewiesen und anderen Grünflächen am Ufer des Baggersees, den die Einheimischen Fidschn nennen. Offiziell heißt er → Heimstettener See.

Album über Bäche, Seen und Weiher
Wälder im Süden
Beim Perlacher Forst handelt es sich um ein gemeindefreies Waldgebiet südöstlich von München.



Sogar wenn am Sonntag die Sonne scheint und es die Menschen ins Freie drängt, kann man im Haderner Forst bzw. Fürstenrieder Wald südwestlich von München entspannt spazieren gehen.




Klosterwald Maria Eich
Franz und Kaspar Thallmayr, die Söhne eines Schmieds in Planegg, stellten um 1710 ein Marienbild in eine hohle Eiche, das nach der Genesung einer Taglöhnerin 1733 eine Marienwallfahrt auslöste. Die Eiche wurde 1742 mit einer Kapelle umbaut. Umgeben ist der Wallfahrtsort im Würmtal vom Klosterwald Maria Eich.










































